Die mendelschen Vererbungsregeln
Aus den Vererbungsregeln können grundlegende genetische Aussagen abgeleitet werden. Erst die quantitative Auswertung von Züchtungsexperimenten ermöglichte die Entdeckung von Vererbungsregeln.
Im Laufe der Zeit führten genaue Beobachtungen und systematische Untersuchungen zu vielfältigen Erkenntnissen über das Vererbungsgeschehen und die genetische IInformation.
Bei den Eukaryoten sind die Chromosomen die Träger der Erbanlagen. Bei vielen Lebewesen wird das Geschlecht durch Geschlechtschromosomen festgelegt.
Erbkrankheiten können auf abweichenden Chromosomenzahlen, auf Veränderungen einzelner Chromosomen oder auf punktuellen Veränderungen einzelner Gene beruhen. Sie werden nach den mendelschen Regeln weitergegeben.
JOHANN GREGOR MENDEL (1822-1884), ein Augustinermönch aus dem Kloster Brünn, veröffentlichte 1866 die Ergebnisse seiner Kreuzungsexperimente an der Erbse (Pisum sativum). Viele Jahre wurden seine Ergebnisse nicht beachtet, obwohl er den so lange vergeblich gesuchten Schlüssel zu den Gesetzmäßigkeiten der Vererbung gefunden hatte. Sein besonderes forschungsmethodisches Vorgehen unterschied ihn von der Arbeitsweise seiner Vorgänger bzw. Zeitgenossen und brachte ihm den Erfolg, der erst nach seinem Tod erkannt wurde.
Forschungsmethodisches Vorgehen von MENDEL
| |
| |
| |
| |
|
MENDEL ist bei seinen Kreuzungsversuchen ursprünglich von 15 Merkmalspaaren ausgegangen. Erst die Reduktion auf 7 brachte klare Ergebnisse. Weil die zugehörigen Erbanlagen auf verschiedenen Chromosomen liegen, traten keine Kopplungen auf.
Durchführung der Kreuzungsversuche
- Pollenentnahme mit einem Tuschepinsel aus der Blüte einer Pflanze, die aus einem gelben Samen hervorgegangen ist.
- Kastration der Blüte einer Pflanze, die aus einem grünen Samen gezüchtet war durch Entfernung der Staubblätter.
- Übertragung des entnommenen Pollens auf die Narbe der weiblichen Blüte und deren Schutz vor Fremdbestäubung.
MENDELs Experimente beruhten auf der Kreuzung von Erbsenpflanzen. In seinen statistischen Auswertungen bezog er sich ausschließlich auf phänotypische Merkmale. Erst nach der Wiederentdeckung der mendelschen Regeln und dem Aufstellen der Chromosomentheorie der Vererbung wurde der Zusammenhang zwischen der Chromosomenverteilung (Träger der Merkmals-Allele) und der Merkmalsausbildung im Phänotyp erkannt. Mittlerweile wurden Kreuzungsexperimente mit vielen verschiedenen Arten durchgeführt.
Dominant – rezessiv – intermediär
MENDEL hatte bei der Wahl seiner Forschungsobjekte Merkmalspaare betrachtet, bei denen das eine Merkmal dominant und das andere rezessiv war. Das dominate Allel bestimmt die Merkmalsbildung. Vollständige Dominanz und vollständige Rezessivität sind aber Grenzfälle, zwischen denen es fließende Übergänge gibt.
Eine weitere Form des monohybriden Erbgangs wurde von CORRENS (1864-1933) beschrieben. Er kreuzte weiß und rot blühende Pflanzen der Wunderblume (Mirabilis jalapa) und erhielt rosa blühende Hybride, es liegt eine intermediäre Merkmalsausbildung vor. Bei einer intermediären Merkmalsausbildung sind beide Allele eines Gens gleichwertig an der Ausprägung des Phänotyps beteiligt (oft treten dadurch z. B. neue Farben auf, die „zwischen“ den Ursprungsmerkmalen liegen).
Terminologie
Mendel führte zur Veranschaulichung seiner Kreuzungsversuche bereits Buchstabensymbole ein und nutzte Kombinationsquadrate. Bis heute ist das aktuell und folgt allgemein festgelegten Grundsätzen.
Die mendelschen Regeln
Die mendelschen Regeln beruhen auf statistisch ermittelten Zahlenverhältnissen der Kreuzungsergebnisse.
1. mendelsche Regel, Uniformitätsregel
Kreuzt man reinerbige (homozygote) Eltern (P), die sich in einem Merkmal unterscheiden, so sind alle Nachkommen (F1) untereinander gleich (uniform).
2. mendelsche Regel, Spaltungsregel
Kreuzt man die Individuen der F1-Generation untereinander, so erhält man in der F2-Generation eine Aufspaltung der Merkmale in festen Zahlenverhältnissen; bei dominant-rezessivem Erbgang 3:1, bei intermediärem Erbgang 1:2:1.
Monohybrid bedeutet, dass nur ein unterschiedliches Merkmalspaar betrachtet wird.
Die heutigen Kreuzungsschemata beruhen auf dem von REGINALD CRUNDALL PUNNET (1875-1926) 1911 in seinem Buch „Mendelism“ dargestellten „PUNNET-Square“-Schema, das die Genotypen in der P-, F1- und F2-Generation wiedergibt.
-
Monohybride Erbgänge
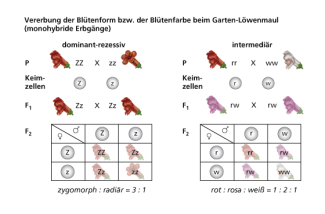
3. mendelsche Regel (Unabhängigkeits- / Neukombinationsregel)
Kreuzt man homozygote Individuen (P), die sich in mehreren Merkmalen voneinander unterscheiden, so wird jedes Merkmal unabhängig von den anderen vererbt.
Dihybrider Erbgang bedeutet, dass zwei unterschiedliche Merkmalspaare betrachtet werden.
Entsprechend der 3. mendelschen Regel treten in der F2-Generation sämtliche Merkmalskombinationen der vorherigen Generationen und zusätzlich noch neue Kombinationen auf. Im Beispiel wären das zygomorphe, rote sowie radiärsymmetrische, weiße Blüten.
Die Gültigkeit der 3. mendelschen Regel für di-, tri- und polyhybride Erbgänge ist nur dann gegeben, wenn die Gene der betrachteten Merkmalsanlagen auf verschiedenen Chromosomen liegen. Befinden Sie sich auf einem Chromosom, werden sie gekoppelt vererbt.
Wenn durch Crossing-over-Vorgänge Genkopplungen verändert werden, entstehen auch neue Merkmalskombinationen, die aber nicht der Unabhängigkeitsregel entsprechen und eine statistische Ausnahme sind. Die 3. mendelsche Regel findet bei der Kreuzungszüchtung Anwendung.
-
Dihybrider Erbgang


