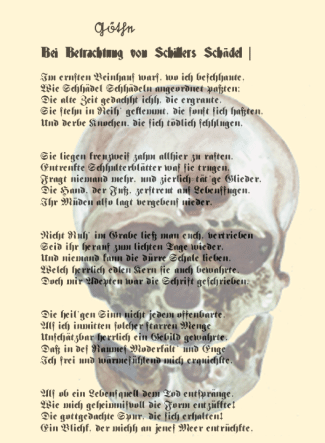Jambische Verse
Der Versfuß ist die kleinste rhythmische Einheit des Verses. Der steigende Versfuß beginnt stets mit einem Auftakt, d.h. der Rhythmus des Verses steigt vom Unbetonten zum Betonten.
Der Jambus ist ein steigender Versfuß. In der Antike bestand er aus einer kurzen und einer langen Silbe, in der deutschen Nachbildung wird dagegen eine unbetonte Silbe und eine betonte Silbe gesetzt.
Gesang (U –)
Verrat (U –)
Das folgende Gedicht STORMs besteht aus jambischen Versen. Die fett gedruckten Silben werden betont:
THEODOR STORM
Die Stadt
Am grauen Strand, am grauen Meer
Und seitab liegt die Stadt;
Der Nebel drückt die Dächer schwer,
Und durch die Stille braust das Meer
Eintönig um die Stadt.
Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai
Kein Vogel ohn Unterlass;
Die Wandergans mit hartem Schrei
Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,
Am Strande weht das Gras.
Doch hängt mein ganzes Herz an dir,
Du graue Stadt am Meer;
Der Jugend Zauber für und für
Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,
Du graue Stadt am Meer.
STORM hat in das Gedicht einige kleine Fallen eingebaut, so könnte man die Verszeile
Eintönig um die Stadt.
auch ganz regelmäßig lesen:
Eintönig durch die Stadt.
Das könnte man sprechtechnisch sogar noch irgendwie nachvollziehen. Obwohl eintönig stets auf der ersten Silbe betont werden muss, sträubt sich unsere Zunge nur wenig, das Wort auf der zweiten Silbe zu betonen. In der Zeile
Kein Vogel ohn Unterlass;
ist das Wort ohn zuviel. Ohne dieses wäre der Vers rein jambisch:
Kein Vogel Unterlass;
Damit die Zeile überhaupt einen Sinn ergibt, hat STORM in den jambischen Vers einen daktylischen (Vogel ohn: – U U) eingebaut. Rein jambisch müsste der nämlich so betont werden:
Kein Vogel ohn Unterlass;
Dagegen wehrt sich die deutsche Zunge heftig. Daraus folgt: Der Rhythmus eines Gedichtes richtet sich stets nach dem natürlichen Sprechrhythmus der Sprache.
Auch der Anapäst ist ein steigender Versfuß, der in der antiken Metrik aus zwei kurzen und einer langen Silbe bestand, im Deutschen aus zwei unbetonten Silben und einer betonten Silbe gebildet wird. Er ist in der deutschen Dichtung seltener als in der griechischen und wurde häufiger erst seit der Romantik angewendet (UU–).
Aber eines verleihst du, o himmlisches Gold, |
was wenige, die dich besitzen,
Zu besitzen verstehn, zu genießen verstehn; |
was ist dies Eine? die Freiheit. (PLATEN.)
Jambische Verse
Jambische Verse sind Verse im jambischen Versmaß.
Zu ihnen gehört die Terzine. Sie ist ein Dreizeiler mit der Hebungs-Senkungsstruktur U – U – U – U – U –(unbetont, betont...). Dabei handelt es sich um fünffüßige Jamben mit dem Reimschema: aba bdb cdc ded efe ...
„Im ernsten Beinhaus war’s wo ich beschaute (a)
Wie Schädel Schädeln angeordnet passten; (b)
Die alte Zeit gedacht‘ ich, die ergraute. (a)
Sie stehn in Reih‘ geklemmt‘ die sonst sich hassten, (b)
Und derbe Knochen die sich tödlich schlugen (c)
Sie liegen kreuzweis, zahm allhier zu rasten.“ (b)
(GOETHE: Bei Betrachtung von Schillers Schädel)
Die Stanze bezeichnet im Allgemeinen einen Haltepunkt oder Abschnitt in einem Gedicht. Sie besteht aus acht fünffüßigen Jamben mit dem Reimschema: abababcc
„Ins Dunkel will des Jahres Licht sich neigen; (a)
Des Lebens heiße Glut, sie kehret wieder (b)
In ew’gen Feuers Schooß zurück; es schweigen, (a)
Die sie entzündet, schon im Hain die Lieder; (b)
Die Liebe flieht, und kalt entlöst den Zweigen (a)
Sich mattes Laub, der Blumen Schmuck sinkt nieder. (b)
Das Herz erstirbt, die Adern sind verschlossen, (c)
Worin Gedeihn und Kraft sich frisch ergossen.“ (c)
(JOHANN WILHELM SÜVERN, Wiedergeburt)
Der Alexandriner ist ein jambischer Reimvers (nach seiner Verwendung in der altfranzösischen Alexanderepik benannt). Es ist die Versform der deutschen Barockdichtung und der französischen Klassik. Eine Verszeile ist aus aus sechs Jamben mit obligater Zäsur (durch ein Wortende markierter Einschnitt) nach der dritten Hebung (betonte Silbe) bzw. von zwölf (männlicher Ausgang) oder dreizehn Silben (weiblicher Ausgang) mit deutlicher Diärese nach der dritten Hebung
„Der schnelle Tag ist hin. / Die Nacht schwingt ihre Fahn.“
(GRYPHIUS: Abend)Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.
Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein:Wo itzund Städte stehn wird eine Wiese sein,
auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden.
Was itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden.
Was itzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein.
Nichts ist, das ewig sei, kein Erz, kein Marmorstein.
Itzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden.
(GRYPHIUS)
Der Blankvers ist ein ungereimter steigender Fünftakter, man nennt ihn den Vers SHAKESPEAREs, im 18. Jahrhundert wurde er aus der englischen Dichtung in die deutsche übernommen.
Es eifre jeder seiner unbestochnen / Von Vorurteilen freien Liebe nach (LESSING)
-
Bei Betrachtung von Schillers Schädel