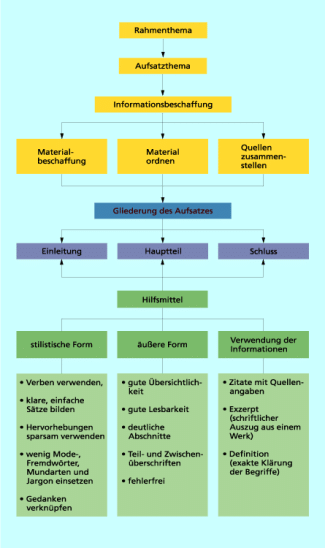Aufsatz
In der Schule wie auch im Alltag werden häufig kürzere Abhandlungen über einen bestimmten Aspekt eines größeren Themas geschrieben. Diese schriftliche Äußerungsform, der Aufsatz, ist ein wichtiger Bestandteil des Deutschunterrichts zur Schulung des Denkvermögens, der Abstraktionsfähigkeit und zur Erweiterung der sprachlichen Möglichkeiten.
Viele schriftliche Mitteilungen in den Medien (z. B. Reportage, Kommentar), in der Öffentlichkeit (z. B. Referat, Rede) oder im privaten Bereich (z. B. Brief, E-Mail) werden in der Aufsatzform verfasst.
Fast alle Arten von schriftlichen Darstellungsformen werden im Deutschunterricht als Aufsatz formuliert.
Dabei sind die Formen von Texten traditionell vorgegebene und bewährte kommunikative Muster. Obwohl jede Textform spezifische äußere Merkmale und unterschiedliche Ausdrucksformen aufweist, ist nicht immer eine klare Abgrenzung möglich. Teilweise sind Übergänge zwischen den Formen fließend.
Zur Vorbereitung eines jeden Aufsatzes gehört:
- Kenntnis über die Darstellungsform und den Stoffbereich. Das Thema muss genau gelesen und die Aufgabe erfasst werden.
- Gedanken/Ideen zum Thema in Stichpunkte fassen und gliedern.
- Gliederung und eine sinnvolle Reihenfolge erarbeiten:
Einleitung: Einführung in das Thema
Hauptteil: inhaltlich wichtigste Ausführung
Schluss: Zusammenfassung der Ergebnisse, eventuell eigene Wertung oder Meinung
- Der erste Satz sollte immer eine Einführung sein. Hier erfolgt noch keine Antwort auf die Frage.
- Im Hauptteil ist Folgendes zu beachten:
- nicht vom Thema abweichen (Leitfrage ist stets: Worum geht es in der Vorlage und Aufgabenstellung?)
- keine Wiederholungen, Widersprüche vermeiden
- nicht plötzlich aufhören, sondern abrundenden Schluss formulieren
- Zeitform beachten
- Stilebenen einhalten (z. B. im Bericht keine Umgangssprache verwenden)
- Perspektive einhalten (z. B. ich oder wir oder man ...)
- vollständige Sätze formulieren
- Absätze vorsehen für neue Gedankengänge
- Grammatik/Rechtschreibung und die äußere Form prüfen
- nicht vom Thema abweichen (Leitfrage ist stets: Worum geht es in der Vorlage und Aufgabenstellung?)
Stilistische Hilfsmittel
Soll etwas erzählt, über etwas berichtet, etwas beschrieben oder etwas erörtert werden, so ist stets Sachkenntnis die erste Voraussetzung. In jedem Satz ist zu überlegen, durch welches Wort bzw. Wendung ein Gegenstand oder Vorgang, eine Person oder eine Eigenschaft am treffendsten bezeichnet werden können.
Die Bezeichnungen sollen nicht nur den Sachverhalt richtig wiedergeben und den Standpunkt des Verfassers zum Ausdruck bringen; sie sollen auch so gewählt sein, dass sie vom Leser oder Hörer entsprechend verstanden werden.
Daraus ergeben sich folgende Hilfsmittel (vgl. Bild 1):
- Nominalstil vermeiden, d. h. Verben verwenden und die Umschreibung mit Substantiven unterlassen.
- Nicht versuchen, zu viel mit einem Satz zu sagen. Klare, einfache Sätze formulieren!
- Hervorhebungen sparsam einsetzen, da sonst der Eindruck der Übertreibung aufkommen kann.
- Die richtige Stilebene wählen. Sie kann von der Art des Gebrauchstextes, von der Kommunikationssituation (Zeitung, Referat, E-Mail) oder vom Leser bzw. Zuhörer (Alter, soziale Stellung, Geschlecht) abhängen.
- Mit Modewörtern sparsam umgehen. Besonders Texte, die sich auf Neuentwicklungen beziehen (Mode, Musik, Gesellschaft etc.), eine bestimmte Leserschaft ansprechen sollen, können durchaus Modewörter enthalten.
Es ist aber zu beachten, dass diese Wörter häufig sehr schnell ihre Aktualität verlieren.
- Mundarten, Jargons nur gezielt verwenden.
- Keine Häufung von Fremdwörtern.
- Gedanken verknüpfen. Oft werden in einem Aufsatz die Gedanken nicht miteinander verbunden. Schon bei der Gliederung kann darauf geachtet werden, dass gleichartige Gedanken aufeinanderfolgen. So werden inhaltliche Brüche und Unverständnis vermieden.
Äußere Form des Aufsatzes
Durch die äußere Form kann man die inhaltliche Aussage eines Textes zum „Klingen“ bringen oder zerstören. Da Aufsätze Sachinformationen enthalten, sollte auch das Schriftbild möglichst sachlich, ohne besonderen ornamentalen Anspruch, erscheinen.
Allerdings ist auf die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zu achten, indem man deutliche Abschnitte, Teilüberschriften und Überschriften hervorhebt. Weiterhin ist es sinnvoll, eine Schrift (wenn am Computer geschrieben wird) zu verwenden und genügend Rand für Korrekturen oder Notizen zu lassen.
-
Übersicht zur Aufsatzgestaltung