Revolution der Lebensdauer
In der Bevölkerung Deutschlands laufen nach bevölkerungsstatistischen Berechnungen zwei Entwicklungen parallel:
- Die Zahl der 60-Jährigen wird zwischen 1989 und 2050 um rund 10 Mio. Menschen zunehmen, während zur gleichen Zeit
- die Zahl der 20- bis 60-Jährigen um 16 Mio. sinken wird.
Zuwachs und Rückgang stehen sich gegenüber. Die Zahl der über 80-Jährigen wird besonders schnell von drei Mio. auf rund 10 Mio. steigen. Die Alterung der Bevölkerung geht auf die erheblich längere Lebensdauer und eine niedrige Geburtenhäufigkeit zurück. Sie ermöglicht neue Formen der individuellen Lebensplanung und Lebensgestaltung.
Umkehr der Alterspyramide
Vor dem Ersten Weltkrieg zeigte die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung (Bild 1) das Aussehen einer Pyramide (Alterspyramide):
- Im Sockel die starken Jahrgänge der Neugeborenen,
- dann durch Tod oder Auswanderung langsam abnehmende Jahrgänge der Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen bis zur
- Pyramidenspitze der nur noch schwachen Jahrgänge über 80 Lebensjahre.
Während des 20. Jahrhunderts wurde die Alterspyramide durch
- große Menschenverluste,
- die Geburtenausfälle zweier Weltkriege und
- die Weltwirtschaftskrise
-
Bevölkerungspyramide für Deutschland 1910, 1995 und 2040
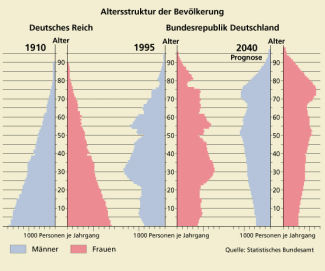
tief aufgerissen und sieht eher einer „zerzausten Wettertanne“ ähnlich – so der Bevölkerungsstatistiker PAUL FLASKÄMPER. Die Bevölkerungsentwicklung tendiert dahin, die Pyramide umzukehren. Die starken Jahrgänge der jetzt 30- bis 60-Jährigen bauchten die Pyramide in der Mitte aus. In weiteren 50 Jahren werden die starken Jahrgänge die Spitze bevölkern und der Sockel wird nur zahlenmäßig kleine Jahrgänge von Neugeborenen aufweisen. Der proportionalen Abnahme bei Kindern und Jugendlichen steht die Zunahme bei den Alten auf ca. das Dreifache gegenüber.
Darin zeigt sich die Alterung der Bevölkerung (demografische Alterung). Die Bevölkerungsentwicklung zugunsten des Anteils der älteren Jahrgänge an der Gesamtbevölkerung hat zwei Hauptgründe, die ihrerseits von ganzen Reihen von Faktoren bestimmt sind:
- den Jahrhunderttrend einer im Vergleich zur vor- und frühindustriellen Zeit geringeren und weiter abnehmenden Geburtenhäufigkeit,
- die ungewöhnliche Steigerung der durchschnittlichen Lebensdauer (Lebenserwartung) seit Ende des 19. Jahrhunderts.
Seit 1871 hat sich die durchschnittliche Lebensdauer verdoppelt. Dabei trat der größte Sprung zwischen 1871 und 1910 auf; seitdem steigt die Lebenserwartung langsamer. Es wird angenommen, dass insbesondere medizinische und sanitäre sowie arbeits-, sozial- und siedlungspolitische Fortschritte sich positiv auf die Lebensdauer ausgewirkt haben.
Die „Revolution der Lebensdauer“ (TOM KIRKWOOD) äußert sich als
- längere Lebensdauer (sie erhöhte sich im 20. Jahrhundert um rund 30 Jahre),
- erhöhte Lebenserwartung auch bei bereits alten Menschen (so können heute 75-Jährige mit einer Lebensdauer von 85-86 Jahren rechnen).
Das Leben dauert je nach Geschlecht und sozialer Schicht im Durchschnitt unterschiedlich lang. Die deutlich längere Lebensdauer der Frauen schon im 20. Jahrhundert hat sich weiter verstärkt. Die Differenz liegt bei fünf bis sechs Jahren und wird u. a. auf günstigere Lebensbedingungen im Haushalt und der Arbeitswelt sowie gesundheitsbewusstere Lebensführung zurückgeführt. Menschen unterer sozialer Schichten tragen ein größeres Risiko, früher zu sterben (Differenz bis zu vier Jahre). Generell gilt, dass die Lebensdauer von sozioökonomischen und soziokulturellen Faktoren, wie Bildung, Beruf, Einkommen und Lebensführung beeinflusst wird.
Folgen der Langlebigkeit
Die demografische Alterung aufgrund steigender Lebenserwartung und niedriger Geburtenhäufigkeit ist ein lang angelegter Prozess, dessen generelle Richtung nicht kurzfristig beeinflussbar scheint. Sie hat praktische Folgen und eröffnet den Menschen neue Lebenschancen, die lange Zeit in Politik und Öffentlichkeit unterschätzt wurden.
- Eine der zentralen Folgen der Langlebigkeit ist die größere Sicherheit, mit der Personen ihre Lebenszeit planen und eine längere Altersphase in die Normalbiografie einfügen können.
- Die Alterung wirkt sich auf die Lebenszusammenhänge der verschiedenen Generationen innerhalb von Familien aus. In Familien leben jetzt bis zu 5 Generationen längere Zeit gemeinsam. Familien sind dadurch vertikaler aufgebaut. Die Familienzusammenhänge haben ihren Ort weniger unter dem Dach einer gemeinsamen Wohnung und eines gemeinsamen Haushalts als vielmehr in einem weiteren Nachbarschaftsraum. Typisch für die Alten sind Zwei- und Einpersonenhaushalte.
- Das Netz der gegenseitigen Unterstützung folgt einem Grundmuster. Nach den Erhebungen des Alters-Surveys erweisen sich rund 40 % der Alten als Geldgeber, während die Kinder vornehmlich praktische Unterstützung im Haushalt, beim Einkaufen und bei kleineren Reparaturen leisten. Aufgrund ihrer materiellen Absicherung im Sozialstaat (Renten u. a.) sind die Alten in der Regel auf materielle Unterstützung nicht angewiesen. Beziehungen zwischen den Generationen ergeben sich aus zahlreichen, meist kleineren bis mittleren Erbschaften von Vermögen, für das in den westlichen Bundesländern in der ungewöhnlichen Wachstumsphase der Wirtschaft der 1950er- und 1960er-Jahre der Grund gelegt wurde.
- Im Kontrast zu den verlängerten Beziehungen zwischen Generationen stehen Befunde zu Jugendlichen, die häufig angeben, keinerlei Kontakt zu den älteren Familienmitgliedern zu haben.
- In der verlängerten Lebensphase übernehmen die Alten produktive Tätigkeiten vor allem bei der Betreuung von Kindern und Enkelkindern (27 % der Altersgruppe der 55- bis 69-Jährigen) und bei der Pflege untereinander. Nur wenige übernehmen freiwillige Ehrenämter in Vereinen und Organisationen; es dominiert der Rückzug in das Private.
- Das geringere Risiko eines frühzeitigen Todes macht es möglich, die traditionellen Lebensabschnitte der Ausbildung, des Berufs, der Kinderzeit anders einzuteilen. So hat der Soziologe RALF DAHRENDORF vorgeschlagen, Phasen der Ausbildung und der Erwerbstätigkeit mehrmals im Leben wechseln zu lassen, um die Älteren in die produktive Tätigkeit einzubeziehen und zugleich den Arbeitsmarkt zu entlasten.
Die Ausgestaltung des längeren Lebens ist eine Aufgabe sowohl der Individuen als auch der Gesellschaft. Viele Überlegungen und Projekte stehen erst am Beginn. Als notwendig zeigt sich bereits, die üblichen Vorstellungen von menschlicher Produktivität und Bildung fortzuentwickeln, ebenso die Leitbilder von den Generationen und ihrer Abfolge. Dies würde einen Grund legen für Aufforderungen der Politik, „lebenslang zu lernen“ oder vermehrt bürgerschaftliches Engagement einzugehen.
Suche nach passenden Schlagwörtern
- TOM KIRKWOOD
- RALF DAHRENDORF
- Geschlecht
- Geburtenhäufigkeit
- Generationen
- Altersstruktur
- Geburtenausfälle
- Betreuung
- Familien
- Weltwirtschaftskrise
- Sozialstaat
- Pflege
- Lebenserwartung
- Weltkriege
- Alters-Survey
- Folgen der Langlebigkeit
- soziale Schicht
- Lebensbedingungen
- bürgerschaftliches Engagement
- Bevölkerungspolitik
- Menschenverluste
- demographische Alterung
- Revolution der Lebensdauer
- Bevölkerungsentwicklung
- Alterspyramide
- PAUL FLASKÄMPER
- Lebensdauer

