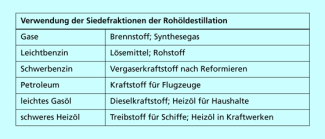Rohöldestillation
Erdöl ist ein komplexes Gemisch, das hauptsächlich aus verschiedenen aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen besteht. Daneben sind schwefel- und stickstoffhaltige Verbindungen enthalten. Bisher konnten über 500 unterschiedliche Stoffe im Erdöl nachgewiesen werden.
Erdölprodukte werden vor allem als Kraft- und Brennstoffe verwendet. Für eine effektive Nutzung muss das Rohöl in verschiedene Fraktionen zerlegt werden, die einheitlichere Eigenschaften aufweisen. Dies geschieht bei der Rohöldestillation. Eine vollständige Trennung in reine Einzelsubstanzen mittels Destillation ist aufgrund der ähnlichen Siedepunkte nicht möglich.
Erdöl enthält eine Vielzahl unterschiedlicher aliphatischer, cyclischer und aromatischer Kohlenwasserstoffe, daneben auch Verbindungen, die Schwefel, Stickstoff, Sauerstoff oder andere Elemente enthalten. Bisher konnte man schon über 500 verschiedene Verbindungen im Erdöl nachweisen, die sich in ihren Eigenschaften zum Teil sehr stark unterscheiden, so finden sich im Erdöl z. B. Verbindungen mit einer Kettenlänge ab vier Kohlenstoffatomen (Siedepunkt < 20 °C) bis hin zu mehr als 50 Kohlenstoffatomen (Siedepunkt > 500 °C).
Ziel der Rohöldestillation ist es, das Erdöl in verschiedene Siedefraktionen zu zerlegen, d. h. in einheitlichere Stoffgemische mit definierten Siedebereichen. Dies geschieht in einer sogenannten Rektifikationskolonne, in der das Rohöl mehrmals hintereinander destilliert wird.
Rektifikation
Gemische verschiedener Flüssigkeiten lassen sich durch Destillation trennen, wenn sich ihre Siedepunkte unterscheiden. Beim Erhitzen eines Gemisches aus zwei Komponenten verdampfen zwar beide Komponenten, diejenige mit dem tieferen Siedepunkt verdampft aber bevorzugt, sodass sie im Kondensat des Dampfes in höherer Konzentration enthalten ist als in der Ausgangsmischung. Der Anreicherungseffekt ist umso größer, je größer die Differenz der beiden Siedepunkte ist.
-
Erdöl ist ein Gemisch vieler unterschiedlicher Stoffe.

zoneteen - adobe stock
Durch einen einmaligen Destillationsschritt kann man in der Regel nicht beide Komponenten in reiner Form gewinnen, dazu muss man den Prozess mehrfach wiederholen, wobei die niedriger siedende Komponente im Kondensat immer mehr angereichert wird. Hierfür werden spezielle Destillationskolonnen eingesetzt, bei denen der aufsteigende Dampf immer wieder kondensiert und erneut verdampft und somit der Destillationsvorgang mehrfach wiederholt wird. Diese Art der Destillation bezeichnet man als Rektifikation oder fraktionierte Destillation.
In der Praxis benutzt man dazu eine Rektifikations- oder Fraktionierkolonne, das ist ein Turm, der Böden spezieller Bauart enthält, z. B. sogenannte Glockenböden (Bild 2).
In der Kolonne herrscht ein Temperaturgefälle, d. h. die untersten Böden sind die heißesten und nach oben hin werden sie immer kälter. Der Dampf, der nach oben strömt, kühlt sich daher ab und kondensiert. Je nach Siedepunkt der enthaltenen Stoffe geschieht dies auf unterschiedlicher Höhe der Kolonne: die Komponenten, die die niedrigsten Siedepunkte haben, kondensieren am weitesten oben. Praktisch findet auf jedem Boden ein Destillationsschritt statt: Auf jedem Boden bildet sich eine Flüssigkeitsschicht, die in Kontakt mit aufwärtsströmendem Dampf und herablaufendem Kondensat steht, was auf den einzelnen Böden zur Anreicherung bestimmter Komponenten mit ähnlichem Siedepunkt führt. Mit zunehmender Höhe werden der Dampf und die Kondensate immer mehr mit der tiefer siedenden Komponente angereichert. Je nach Differenz der Siedepunkte braucht man für die Trennung daher unterschiedlich hohe Kolonnen, bei der Rohöldestillation sind sie bis zu 50 m hoch.
Am oberen Ende der Kolonne, dem Kopf, wird dann der Dampf der reinen tiefer siedenden Komponente entnommen und kondensiert. Um den Trenneffekt in der Kolonne zu verbessern, wird aber nicht das gesamte Kondensat als Produkt entnommen, sondern ein Teil wieder als sogenannter Rücklauf in die Kolonne zurückgeführt (Rektifikation unter Rücklauf).
Das herablaufende Kondensat wird durch den aufsteigenden heißen Dampf wieder verdampft, letzterer kühlt sich dabei ab, es stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Dampf und Kondensat ein. Durch die Menge an Rücklauf kann somit das Temperaturgefälle in der Kolonne und damit die Trennschärfe beeinflusst werden.
Ein Vielkomponentengemisch wie Erdöl mit sehr eng beieinanderliegenden Siedepunkten kann man durch Rektifikation nicht vollständig in seine Einzelkomponenten auftrennen. Man zerlegt es daher in sogenannte Siedefraktionen, also Fraktionen, die in einem bestimmten Temperaturbereich sieden.
-
Schematische Darstellung zweier Glockenböden in einer Rektifikationskolonne
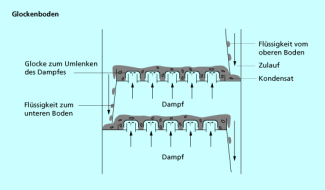
Fraktionierung von Erdöl
Bei der Rektifikation des Erdöls kondensiert der eingeleitete Dampf beim Aufsteigen stufenweise, sodass das Kondensat in verschiedenen Höhen der Kolonne bestimmte Siedebereiche aufweist, die als sogenannte Siedefraktionen seitlich aus der Kolonne entnommen werden. Auch hier wird zur Verbesserung des Trenneffektes ein Teil der obersten Fraktion (Leichtbenzin) als Rücklauf wieder in die Kolonne gegeben.
Die Rohöldestillation wird in zwei Fraktionierkolonnen durchgeführt, einer Normaldruck-Fraktionierkolonne und einer Vakuum-Fraktionierkolonne (Bild 4). Unter Normaldruck werden die Anteile, die unter 360 °C sieden, verdampft und somit getrennt.
Der flüssige Rückstand, der bei über 360 °C siedet, wird in die Vakuumkolonne geleitet und dort weiter aufgetrennt. Im Vakuum liegen die Siedepunkte niedriger, wodurch eine weitere Auftrennung des flüssigen Rückstands aus dem ersten Fraktionierungsschritt möglich wird.
Als Vakuumrückstand bleibt Bitumen übrig, das sind Bestandteile, die erst bei mehr als 500 °C sieden. Alternativ zur Vakuumfraktionierung kann der flüssige Rückstand aus der ersten Rektifikation auch thermisch gecrackt werden.
-
Schematischer Aufbau und unterschiedliche Fraktionen bei der Rohöldestillation
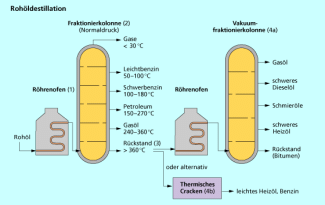
-
Siedefraktionen bei der Rohöldestillation