Sprachliche Veränderung
Die sprachlichen Veränderungen, die sich ab 1050 in Ablösung des Althochdeutschen durchsetzten, vollzogen sich als ein Prozess, also nicht gleichmäßig in allen Regionen. So begann der Endsilbenschwund beispielsweise im Fränkischen, während sich die Endsilben im Alemannischen noch im 16. Jahrhundert hielten.
Durch die Ostexpansion wurde die hochdeutsch-niederdeutsche Sprachscheide um die Punkte Wittenberg–Lübben–Frankfurt/Oder nach Osten hin verlängert. Allerdings kamen die Kolonisten aus verschiedenen Regionen Deutschlands, was zu einer Vermischung der Dialekte führte.
Das Mittelhochdeutsche beinhaltete Veränderungen in phonologischer, morphologischer, syntaktischer, lexikalischer und semantischer Hinsicht.
Entwicklung des Mittelhochdeutschen
Die sprachlichen Veränderungen, die sich ab 1050 in Ablösung des Althochdeutschen durchsetzten, vollzogen sich als ein Prozess, also nicht gleichmäßig in allen Regionen. So begann der Endsilbenschwund beispielsweise im Fränkischen, während sich im Alemannischen die Endsilben noch im 16. Jahrhundert hielten.
Durch die Ostexpansion wurde die hochdeutsch-niederdeutsche Sprachscheide um die Punkte Wittenberg–Lübben–Frankfurt/Oder nach Osten hin verlängert. Allerdings kamen die Kolonisten aus verschiedenen Regionen Deutschlands, was zu einer Vermischung der Dialekte führte.
-
Mittelhochdeutsche Sprachveränderungen
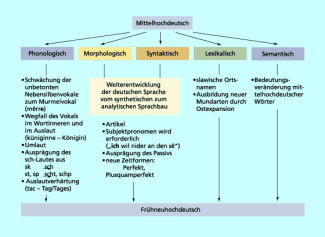
Sprachliche Veränderungen
Die sprachliche Entwicklung vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen beinhaltete Veränderungen in phonologischer, morphologischer, syntaktischer, lexikalischer und semantischer Hinsicht. Die Sprachänderungen betrafen vor allem folgende Merkmale oder Formen:
Der Artikel wird zu einem wichtigen syntaktischen Mittel
(ahd. zungun, zunguono, zungom, zungun wird zu >
mhd. die zungen, der zungen, den zungen, die zungen).
Im Plural wird der Umlaut zu einem wichtigen sprachlichen Merkmal
(ahd. bruother > mhd. brüeder).
Unbetonte Nebensilben werden abgeschwächt, Vorsilben zusammengezogen
(ahd. bi > mhd. be;
ga, gi > ge;
za, zi > ze;
ur, ir > er;
fur, fir > ver).
Verschiedene Flexionsendungen fallen zusammen
(ahd. zala > diu zal = die Zahl).
Unbetonte Mittelsilben werden weggelassen
(ahd. kiricha > mhd. Kirche, himeles > himels).
Die Diphthongierung breitet sich weiter aus
(ahd. wihrouch > mhd. weirauch).
Neue Wortbildungsmittel entstanden, beispielsweise erfolgte die Substantivierung des Adjektivs mit einer Nachsilbe, wie
-igkeit, -heit, -keit, -ung. (Im Althochdeutschen konnte ein Adjektiv durch î substantiviert werden.)
Im Zuge der Ostexpansion werden alte slawische Ortsnamen übernommen. Darauf verweisen Suffixe wie
-ow, -ig, -itz (Koserow, Sassnitz, Danzig, Leipzig).

