Spezifische Immunreaktion
Gegenstand der Immunbiologie sind die biologischen und chemischen Abwehrmechanismen eines Organismus als Selbstschutz gegen die pathogene Wirkung von Fremdsubstanzen. Die Erkennung von Selbst und Fremd ist maßgebliche Voraussetzung für die Abwehr. Spezifische Immunität beruht auf zellulären und humoralen Faktoren.
Immunbiologie
Die Antisomatogene („gegen den Körper bildend“), kurz Antigene genannt, werden durch ihre körperfremde Struktur zum Auslöser für die immunologischen Reaktionen. Das Abwehrsystem des Körpers ist harmonisch aufeinander abgestimmt und reagiert graduell unterschiedlich, je nach Stärke der Bedrohung des Organismus. Grundsätzlich kann man die Infektabwehr in einen unspezifischen, die Resistenz, und einen spezifischen Bereich, die Immunität, einteilen.
Spezifische Immunreaktion
Aufgrund der optimalen Lebensbedingungen innerhalb homoiothermer (gleichwarmer) Organismen und der damit verbundenen Vermehrungsrate pathogener Keime sind die beiden ersten Barrieren des Körpers schnell überfordert. In solchen Fällen mobilisiert das Abwehrsystem seine stärkste Waffe, die spezifische Immunreaktion. Die hohe Spezifität dieser Immunantwort bedingt jedoch, dass sie erst dann in Gang gesetzt werden kann, wenn der Körper Kontakt mit dem betreffenden Antigen hat. Es handelt sich also um eine erworbene Fähigkeit, weshalb man auch von einer adaptiven Immunantwort spricht. Hier werden gleich zwei Abwehrreihen aufgefahren. Beide Systeme laufen nebeneinander im Körper ab, ergänzen sich aber nachhaltig in ihrer Wirkung gegenüber pathogenen Keimen (Bild 1).
| Das Immunsystem des Menschen im Überblick | |
| primäre lymphatische Organe | |
| rotes Knochenmark (bone marrow) | - Ausgangspunkt der Blutbildung - Ausdifferenzierung und Determination der B-Lymphozyten |
| Thymus | - Klonierung und immunspezifische Prägung der Vorläuferzellen zu immunologisch kompetenten T-Lymphozyten |
| sekundäre lymphatische Organe | |
| Lymphknoten | - Lymphe = Ultrafiltrat des Bluts in den Interzellularräumen bzw. Gewebslücken - Anreicherung mit Lymphozyten - Prägung durch Kontakt mit Antigenen |
| Milz | - immunologische Pforte im hinteren Rachenraum um Luft- und Speiseröhre - enthält Lymphozyten - Erstkontakt mit Antigenen |
| Mandeln | - Klonierung von Lymphozyten bei Infektionen - Blutspeicher |
-
Humorale und zelluläre Reaktionen sind die zwei Abwehrreihen der adaptiven Immunantwort.
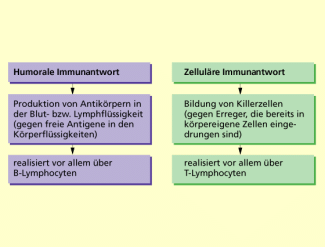
Die Lymphozyten und ihre Untergruppen lassen sich durch ihre membrangebundenen Oberflächenmarker systematisieren. So besitzen alle T-Helferzellen das Molekül CD4, alle T-Killerzellen CD8 und auf den B-Lymphozyten sind Immunglobuline (IgM) als Rezeptoren für die Antigenbindung situiert. CD (= cluster of differentiation) klassifizieren die exprimierten Proteinmoleküle der Biomembran. Die mobilen Zellen des Immunsystems entwickeln sich aus pluripotenten Stammzellen im Knochenmark (Bild 2).
Unter dem Einfluss von Wachstums- und Differenzierungsvorgängen entstehen Vorstufen der späteren Differenzierungslinien, die Kolonie bildenden Einheiten. Die T-Lymphozyten verlassen als undeterminierte Vorläuferzelle das Knochenmark und wandern zur vollständigen Ausdifferenzierung in den Thymus ein.
-
Zelltypen der Immunantwort
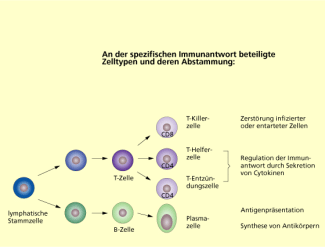
Renate Diener
Immunantwort
Der Ablauf der Immunantwort nach Infektion gliedert sich in die zwei Abwehrreihen der humoralen und der zellulären Immunabwehr (Bild 3) wie folgt:
Infektion und Phagocytose
In den Körper gelangte Antigene, die nicht sofort in ihre Wirtszellen eindringen, können in den sekundären lymphatischen Organen von Makrophagen bzw. B-Lymphozyten kontaktiert und anschließend durch Phagocytose aufgenommen werden.
Prozessierung und Präsentation
Im Inneren der Zellen werden die Antigene prozessiert, das heißt abgebaut und bearbeitet. Die entstandenen kurzkettigen Peptide werden an MHC-Moleküle gebunden und an die Zelloberfläche transferiert, wo die Antigenfragmente – werden auch als Epitope oder antigene Determinanten bezeichnet – den T-Lymphozyten präsentiert werden.
Erkennung und Aktivierung
Unter 100 000 dieser T-Zellen, die in Blut und Lymphe kursieren, besitzt nur eine den für das Epitop kompatiblen T-Zell-Rezeptor. Die Anlagerung erfolgt über das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Durch CD4- bzw. CD8-Co-Rezeptoren der T-Lymphozyten wird diese Bindung stabilisiert.
Differenzierung
T-Lymphozyten mit CD4-Rezeptoren entwickeln sich zu T- Helferzellen. Beim Vorhandensein von CD8-Rezeptoren kommt es zur Entwicklung von T-Killerzellen. Zur Aktivierung der Lymphozyten ist der Kontakt mit mehreren Oberflächenmarkern zur Antigen präsentierenden Zelle notwendig. Für die interzelluläre Kommunikation sind Cytokine verantwortlich. Cytokine sind Proteine oder Glykoproteine, die als Botenstoffe wirksam werden.
Klonselektion
Die bis zu diesem Zeitpunkt ruhende T-Zelle beginnt sich zu teilen, sodass innerhalb kürzester Zeit ein Klon (erbgleiche Zelle) mit absoluter Antigenspezifität entsteht. Gleichzeitig wird die Synthese von Botenstoffen (Cytokinen) wie Interleukin 2 angeregt.
Memory, das immunologische Gedächtnis
B- und T-Zellen können nach ihrer ersten Stimulierung durch Kontakt mit Antigen präsentierenden Makrophagen ihre Weiterentwicklung unterbrechen und zu langlebigen Gedächtniszellen werden.
Antigen-Antikörper-Reaktion (AAR)
Die während der Immunisierung gebildeten spezifischen Antikörper lagern sich über komplementäre Molekülstrukturen der beiden Reaktionspartner durch nicht kovalente Bindungen mit den Antigenen zu Antigen-Antikörper-Komplexen zusammen.
Lyse infizierter Körperzellen
Durch Pathogene infizierte Körperzellen präsentieren auf ihrer Zelloberfläche an MHC-Moleküle gebundene antigene Determinanten. T-Killerzellen binden sich mittels ihrer spezifischen Rezeptoren an diese markierten Zielzellen. Das von T-Killerzellen produzierte Perforin wird nach Kontakt mit der infizierten Körperzelle exocytotisch freigesetzt. Die Perforinmoleküle verursachen nach Polymerisierung eine Durchlöcherung der Zellmembran, der resultierende Cytoplasmaverlust führt zur Lysis und zum Tod der infizierten Zielzelle.
-
Ablauf der Immunantwort
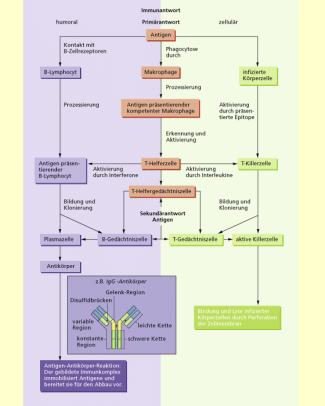
Renate Diener

