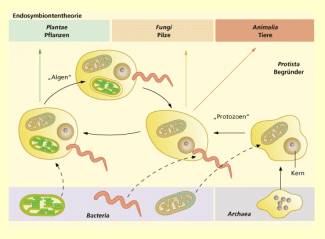Symbiogenese
Das Zusammenleben und die Wechselwirkungen über Art-Grenzen hinweg sind ein wichtiges Charakteristikum des Lebens und der Lebensvorgänge. Die Wechselbeziehungen verschiedener Lebewesen werden durch Konkurrenz, Symbiose, Karpose und Antibiose beschrieben. Wenn durch Symbiose neue Arten entstehen, spricht man von Symbiogenese.
Ein für die Evolution besonders wichtiges Symbiogenese-Ereignis war die Entstehung der Euraryota durch Endosymbiose aus verschiedenen Prokaryoten (Endosymbiontentheorien).
Einmal zeichnet sich Leben durch Individualität und damit durch Grenzen und Grenzziehungen aus. Zum anderen sind alle diese Grenzen – angefangen von den intrazellulären Membranen – „semipermeabel“: Wechselwirkungen über diese Barrieren hinweg sind ein Charakteristikum aller Lebensvorgänge und auch aller Lebewesen. Dazu gehören auch Wechselwirkungen mit anderen Individuen und anderen Arten.
Im Hinblick auf die biologische Evolution wurde dieses wichtige Prinzip bis heute nicht ins rechte Licht gerückt – möglicherweise als Folge des unglücklichen Begriffs vom „Kampf ums Dasein“ und der mit diesem Schlagwort verbundenen populärwissenschaftlichen und biologistischen Interpretationen der Evolutionstheorie. Dabei wurde die große Bedeutung des „Zusammenlebens“ schon in der zweiten Hälfte des 19. Jh. von vielen Biologen erkannt und beschrieben. A. F. W. SCHIMPER (1856–1901) äußerte bereits 1883 die Vermutung, dass Plastiden Algenendosymbionten in Zellen sein könnten. Die Theorie geriet zunächst in Vergessenheit. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten des 20. Jh. sorgte vor allem die amerikanische Biologin LYNN MARGULIS (geb. 1938) dafür, dass so viele Beweise für diese „Endosymbiontentheorie“ zusammengetragen wurden, dass sie heute als vollständig gesichert gilt.
Es ist nun unumstritten, dass eukaryotische Zellen das Produkt einer Fusion von Archäen mit verschiedenen Bakterien darstellen. MARGULIS geht in ihrer Einschätzung der Bedeutung von Symbiosen für die Evolution der Lebewesen allerdings deutlich weiter als die meisten zeitgenössischen Evolutionsbiologen. Sie zweifelt daran, dass neue Arten durch zufällige Mutationen entstehen und nimmt vielmehr an, dass die meisten evolutionären Neuerungen direkt aus Symbiosen hervorgegangen sind und immer noch hervorgehen. Sie schreibt: „Der wichtigste Ausgangspunkt für evolutionäre Neuerungen ist die Anhäufung von Symbionten; das alles wird daraufhin durch die natürliche Auslese bearbeitet. Aber niemals geschieht das nur durch die Anhäufung von Mutationen allein", und „ich nehme an, dass Menschen wie alle anderen Affen nicht das Werk Gottes sind sondern das Ergebnis einer tausenden von Jahrmillionen währenden Interaktion höchst reaktionsfreudiger Mikroben.“
Auch so wichtige Lebewesen wie Schwämme, Korallen oder herbivore Säugetiere basieren auf zwischenspezifischer Integration. Von Prokaryoten weiß man, dass diese Integration bis zur Vermischung der Genome gehen kann. Dieser horizontale Gentransfer (HGF) – Genübertragung zwischen verschiedenen Arten – dürfte jedoch auch für die Evolution der Eukaryoten eine größere Bedeutung haben als lange Zeit angenommen.
-
Endosymbiontentheorie