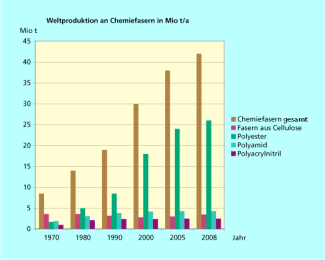Chemiefasern (Kunstfasern)
Textilien schützen uns vor Witterungseinflüssen. Unsere Ansprüche an die Kleidung gehen aber viel weiter. Heute steht uns für die Fertigung von Kleidung eine große Vielfalt an Textilfasern zur Verfügung. Bis ins 20. Jahrhundert wurden ausschließlich Naturfasern auf Basis von Cellulose (Baumwolle) oder Eiweißen (Wolle) verwendet. Mit der Entwicklung der Kunststoffchemie in den 30er-Jahren ergaben sich jedoch völlig neue Möglichkeiten, synthetische makromolekulare Stoffe zu Fasern zu verarbeiten. Diese Kunstfasern bzw. synthetischen Fasern sind aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken.
Fasern
Der Begriff „Faser“ ist ein Sammelbegriff und umfasst viele Materialien unterschiedlicher Herkunft. Als Fasern bezeichnet man gemeinhin alle lang gestreckte Aggregate von Molekülen oder Kristalliten, die überwiegend in eine Richtung des Raumes ausgerichtet sind. Dabei können die Fasern eine sehr unterschiedliche Länge aufweisen. Wir wollen uns hier hauptsächlich mit den makromolekularen Fasern beschäftigen, die für die Herstellung von Textilien verwendet werden.
Seit Menschengedenken versucht sich jeder gegen Wind, Kälte, Sonneneinstrahlung und Niederschlag zu schützen. Hüllte man sich anfangs in Felle und Tierhäute, so kamen später verflochtene und verwobene Naturfasern wie Haare, Bast, Leinen, Flachs, Wolle, Baumwolle, Leinen und Seide hinzu.
Allerdings werden die natürlich nachwachsenden Fasern qualitativ und mengenmäßig nicht unserem Bedarf gerecht. Zum einen unterliegt die Produktion pflanzlicher und tierischer Fasern biologischen Gesetzen und somit jahreszeitlichen Schwankungen, zum anderen zwingt die wachsende Weltbevölkerung vorhandene Anbauflächen für den Anbau von Nahrungsmitteln zu nutzen. Auch der Platz für Schafe und Ziegen wird dadurch begrenzt.
Mit der Entdeckung der synthetischen Makromoleküle bot sich unabhängig von biologischen Faktoren eine neue, preiswerte Alternative zu den Naturfasern. Die neuen Polymere boten zudem ein breites Spektrum interessanter Eigenschaften und sind für viele Zwecke besser geeignet als die traditionellen Textilfasern. Nicht zuletzt spielt heute auch der Modeaspekt eine Rolle.
So wurde das Faserspektrum durch Chemiefasern ergänzt, die viele neue Möglichkeiten des Einsatzes bieten. Gerade Fasern auf der Basis synthetische Polymere können entsprechend ihrer geplanten Verwendung entwickelt und ihre Eigenschaften optimiert werden. Heute existiert ein breites Spektrum an Fasern, die nicht nur für die Herstellung von textilem Gewebe genutzt werden.
An Textilfasern werden sehr hohe Anforderungen hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften gestellt. Synthesefasern werden daher oft genau für einen bestimmten Einsatz entwickelt. Eine moderne Synthesefaser bzw. ein aus ihr gefertigtes Gewebe muss folgenden Ansprüchen genügen:
| Das Gewebe soll gegen Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse unempfindlich sein (dies ist nicht nur beim Tragen sondern auch beim Waschen von Bedeutung). | |
| Es soll in der Lage sein, unseren Körperschweiß aufnehmen zu können und im Idealfall nach außen ableiten. | |
| Es soll eine hohe mechanische Festigkeit aufweisen, denn nur so ist bei Beanspruchung eine gewisse Lebensdauer garantiert. | |
| Das Gewebe, die Faser soll dehnbar sein; nur so ist einer Textilie Bequemlichkeit zu bescheinigen. | |
| Die Faser soll lichtecht, und möglichst unempfindlich gegenüber Mikroorganismen und Schädlingen sein. | |
| Das Gewebe muss ohne gesundheitliche Probleme (Allergien o. ä.) auf der Haut tragbar sein und auch sonst ein angenehmes Empfinden bei Hautkontakt erzeugen. | |
| Die Herstellung und Verarbeitung des Materials müssen aus ökologischer (Schadstoffe und andere Umweltfolgen) und ökonomischer Sicht (Preis) vertretbar sein. |
-
Übersicht über Faserarten
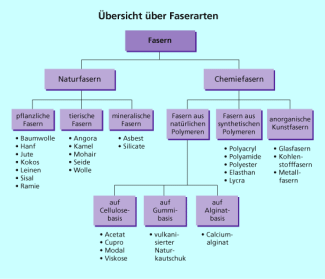
Fasern
Chemiefasern sind der Überbegriff für chemisch veränderte Naturfasern (halbsynthetische Fasern) und für durch Aufbaureaktionen aus Monomeren gewonnene Synthesefasern.
Baumwollfasern bestehen aus dem Polyzucker Cellulose, sie werden zu einem langen Faden versponnen. Cellulosefasern sind auch im Holz enthalten. Hier sind sie aber im Verbund mit den anderen Polymeren Hemicellulose und Lignin. Diese müssen zuerst von der Cellulose abgetrennt werden. Aus der so gewonnenen Cellulose (dem Zellstoff) kann man Papiertaschentücher aber keine Gewebe herstellen. Die Cellulose ist unlöslich und schmilzt nicht, wenigstens eine dieser Eigenschaften ist nötig, um einen Faden zu erzeugen.
Man muss die Cellulose daher modifizieren, beispielsweise indem man die OH-Gruppen der Zuckermoleküle mit Essigsäure verestert. Der Celluloseester ist dann in organischen Lösemitteln löslich und man kann aus der Lösung einen Faden gewinnen.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, Cellulose zu modifizieren, um dann Fäden erzeugen zu können.
Diese halbsynthetischen Fasern (Kunstseiden, Viskose) basieren auf natürlichen Polymeren und nehmen eine Sonderstellung unter den Chemiefasern ein (Bild 3). Auch heute werden etwa 11 % der Fasern so erzeugt.
Da der Nobelpreisträger HERRMANN STAUDINGER erst 1927 den grundlegenden Aufbau von makromolekularen Kunststoffen erkannte, konnte das erste celluloseunabhängige Produkt, das „NYLON“, erst in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts synthetisiert werden. Heute werden die meisten Textilien aus synthetischen Fasern produziert (Bild 4).
Herstellung von
Synthesefasern
Grundsätzlich werden organische Hochpolymere mithilfe von drei Reaktionsarten synthetisiert.
- Polymerisation: Monomere mit mindestens einer Mehrfachbindung zwischen den Kohlenstoffatomen der Moleküle verbinden sich unter Aufspaltung dieser Mehrfachbindungen zu Makromolekülen (Polymeren). Beispielsweise werden PVC-, Polyacryl- und einige Polyamidfasern werden durch Polymerisation synthetisiert.
- Polyaddition: Bei der Polyaddition reagieren Monomere, die zwei oder mehr funktionelle Gruppen aufweisen, miteinander zu Makromolekülen, wobei es bei der Bindungsknüpfung zur Umlagerung eines Wasserstoffatoms kommt. Im Gegensatz zur Polykondensation entstehen hierbei keine Reaktionsnebenprodukte. Auf diesem Wege werden z. B. Elasthanfasern hergestellt.
- Polykondensation: Bei der Polykondensation werden aus vielen Molekülen unter Abspaltung kleinerer Moleküle (und meist Wasser) Makromoleküle gebildet. Einige Polyamide und Polyester werden durch Polykondensation synthetisiert.
Allerdings sind nicht alle Kunststoffe zur Herstellung von Fasern geeignet.
Um lange Fasern (aus natürlichen oder synthetischen Polymeren) zu erzeugen, bedient man sich verschiedener Spinnverfahren.
Im Gegensatz zum Spinnen von Wolle, wo kurze Wollfasern zu einem langen Faden verdrillt werden, bedeutet Spinnen hier etwas anderes. Das Polymer wird in flüssige Form (Lösung oder Schmelze) gebracht, durch Düsen gepresst und kann als fester, praktisch Endlosfaden abgezogen werden. Solche Fäden (Monofil) nimmt man beispielsweise für die Herstellung von Damenstrümpfen (Nylons).
Man kann aber die Endlosfäden wieder in kurze Fasern mit ähnlicher Länge wie Woll- oder Baumwollfasern zerschneiden und diese Fasern wieder zu einem langen Faden verdrillen. Dabei werden Luftbläschen eingeschlossen und aus dem Faden kann man ein wärmendes Gewebe fertigen. Man unterscheidet:
- Trockenspinnen: Das in einem tief siedenden Lösungsmittel gelöste Polymer wird durch eine Spinndüse gedrückt und an einem das Lösungsmittel verdampfenden Luftstrom vorbeigeleitet (z. B. Herstellung von Acetaten).
- Nass-Spinnen: das in einem Lösungsmittel gelöste Polymer wird in ein Bad gepresst, in dem die Faser aushärtet (z. B. Herstellung von Viskose).
- Schmelzspinnen: Das Verfahren kann für Kunststoffe angewendet werden, die unter Hitzeeinwirkung ohne Zersetzung erweichen (Thermoplaste). Das geschmolzene Polymer wird durch eine Düse gedrückt und erstarrt dann beim Erkalten (z. B. Herstellung von Polyamiden und Polyestern).
Ist die Faser der Düse entkommen, muss sie über mehrere Behandlungsstufen in Form gebracht werden, sie muss gestreckt, dann gekräuselt und dann in der neuen Form durch Erwärmen noch einmal fixiert werden.
Verarbeitung der Fasern
Die Fasereigenschaften hängen jedoch nicht nur vom Polymer, sondern auch von der nachfolgenden Faserverarbeitung ab. Es kommt darauf an, wozu die Faser jeweils versponnen werden soll. Ein Regenschirm sollte sich von einer Fleecejacke unterscheiden, auch wenn sie aus ähnlichen Materialien bestehen!
Es gibt viele Möglichkeiten, die Eigenschaften einer Faser zu beeinflussen. Schon die Wahl der Spinndüse kann den Glanz oder die Isolierungseigenschaften bestimmen. Man kann der Spinnmasse aber auch „Stumpfmacher“ hinzusetzen, damit beispielsweise die daraus gefertigte Hose in der Sonne nicht wie ein Lackschuh glänzt.
Außerdem sollen die Oberschenkel beim Laufen keine Funken schlagen! Synthesefasern neigen dazu, sich elektrostatisch aufzuladen. Um dies zu verhindert, können Gleitmittel zugefügt werden. Es ist sogar möglich, durch entsprechend Zusatzstoffe dem Befall mit Schädlingen, Pilzen und Flechten vorzubeugen.
Ganz entscheidend für den Tragekomfort und für die Produktion von Funktionstextilien für die unterschiedlichen Sportarten ist jedoch die Eigenschaft eines Gewebes, Schweiß nach außen abzutransportieren, ohne Feuchtigkeit nach innen einzulassen. Diese beiden Eigenschaften sind jedoch normalerweise nicht miteinander zu vereinen.
Seit Neustem werden jedoch Gewebe aus sogenannten Mikrofasern und mit Beschichtungen angeboten, die diese schwierige Aufgabe erfüllen. Mikrofasern sind sehr feine Fasern, die 10 mal dünner als ein Menschenhaar sind. Ein Gramm einer Mikrofaser entspricht daher ungefähr einer Länge von 10 km. Sie werden durch verbesserte Spinnverfahren aus verschiedenen Stoffen hergestellt.
Gewebe aus Mikrofasern sind extrem dicht. Regentropfen mit ihrer auf der Oberflächenspannung des Wassers beruhenden Form, können nicht in das Gewebe eindringen. Da die Gewebe aber trotzdem keine geschlossene Oberfläche bilden, kann der Schweiß und Wasserdampf die dichte Struktur von innen nach außen verlassen (Bild 5).
Die gleiche Wirkung kann man durch das Aufbringen einer hauchdünnen Membran auf ein Grundgewebe erzielen. Verwendet man Membranen aus Teflon erhält das Produkt den Namen Goretex. Teflon ist ein fluorhaltiger Kunststoff, der auch als Antihaftbeschichtung von Pfannen in unser tägliches Leben Einzug gehalten hat.
Ist das Gewebe mit einer Membran aus Polyester beschichtet, trägt das Produkt den Namen Sympatex. Die grundsätzlichen Trageeigenschaften unterscheiden sich kaum.
Die Produktion von Kunstfasern gestattet heute eine unglaubliche Produktpalette. Für jeden Anspruch wird eine Faser „maßgeschneidert“, sodass in diesem Beitrag nur ein kleiner Einblick in die Vielfalt der Chemiefasern gegeben werden kann.
Wirtschaftliche Bedeutung der Synthesefasern
Die Welt-Produktion an Textilfasern hat sich seit 1970 verdreifacht. Wegen begrenzter Möglichkeiten konnte die Baumwollmenge aber nur verdoppelt werden, die Chemiefasermenge stieg hingegen um den Faktor 5.
Bei den Chemiefasern ist die Menge an halbsynthetischen Cellulosefasern in diesem Zeitraum nahezu konstant. Bei den drei wichtigsten Synthesefasern Polyester, Polyamid und Polyacrylnitril fällt besonders die Steigerung bei Polyester auf. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich die wirtschaftlich günstigere Verfügbarkeit der Ausgangsstoffe.
Weltweit wurden im Jahr 2008 etwa 67 Mio. t Textilfasern hergestellt, der Anteil der Chemiefasern liegt z. Z. bei 62 %. Die wichtigste Synthesefaser Polyester hat aber Baumwolle in der Herstellungsmenge bereits überholt.
In Deutschland wurden im Jahr 2008 etwa 800 000 Tonnen Chemiefasern produziert (davon 185 000 t halbsynthetische auf Cellulosebasis, 240 000 t Polyester sowie je 160 000 t Polyamid und Polyacrylnitril), im Jahr 2009 sank die Produktion rezessionsbedingt auf etwa 700 000 t.
Weltproduktion an Textilfasern in Mio. t pro Jahr:
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | |
| Textilfasern gesamt | 22 | 30 | 40 | 52 | 65 | 67 | 69 |
| Naturfasern gesamt | 14 | 14 | 22 | 22 | 26 | 26 | 25 |
| Baumwolle | 12 | 13 | 14 | 21 | 24 | 25 | 24 |
| Wolle | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Chemiefasern gesamt | 8,5 | 14 | 19 | 30 | 38 | 42 | 44 |
Weltproduktion an Chemiefasern in Mio. t pro Jahr:
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | |
| Chemiefasern gesamt | 8,5 | 14 | 19 | 30 | 38 | 42 | 44 |
| Fasern aus Cellulose | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,8 |
| Polyester | 1,7 | 5,0 | 8,5 | 18 | 24 | 26 | 32 |
| Polyamid | 1,9 | 3,1 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,5 |
| Polyacrylnitril | 1,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
-
Zunahme der Weltproduktion an Textilfasern
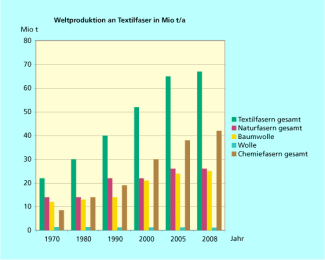
-
Zunahme der Weltproduktion an Chemiefasern