Haltung Goethes und Schillers zur Französischen Revolution
SCHILLER hatte die Veränderungen in Frankreich anfänglich noch begrüßt und begann sich erst mit dem jakobinischen Terror 1793 von der Französischen Revolution zu distanzieren.
GOETHE dagegen schuf mit seinem Ideal der griechischen Klassik ein Gegenbild zur Revolution in Frankreich.
Beide waren der Auffassung, die Entwicklung der Gesellschaft dürfe nicht mit Gewalt in eine neue Richtung gedrängt werden. Diese Haltung begründete ihre Freundschaft.
Die Haltung deutscher Intellektueller zur Französischen Revolution
Die Haltung deutscher Intellektueller zur Französischen Revolution war bis 1792 fast ungeteilt positiv:
- FRIEDRICH HÖLDERLIN,
- GEORG FORSTER,
- FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK,
- CHRISTOPH MARTIN WIELAND,
- CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL SCHUBART,
- FRIEDRICH STOLBERG,
- FRIEDRICH VON GENTZ,
- WILHELM LUDWIG WEKHRLIN u. a.
begrüßten emphatisch die Vorgänge in Frankreich. KLOPSTOCK schrieb seine berühmte Ode „Sie und nicht wir“ (1790). JOHANN WILHELM VON ARCHENHOLZ stellte 1789 fest:
„die französische Revolution verdrängt durch ihr gewaltiges Interesse alles; die besten Gedichte bleiben ungelesen. Man greift nur noch nach Zeitungen und solchen Schriften, die den politischen Heißhunger stillen.“
(Johann Wilhelm von Archenholz, in: Minerva, Bd. 7, August 1793, S. 199.)
Die Haltung GOETHEs
GOETHE hatte als Begleiter des Herzogs KARL AUGUST den 1. Koalitionskrieg (1792–1797) der Österreicher und Preußen gegen die Franzosen erlebt und stand seitdem der Revolution sehr ablehnend gegenüber.
GOETHE setzte sich jedoch in verschiedenen Werken mit der Französischen Revolution auseinander:
- Der Groß-Cophta (1791)
- Das Mädchen von Ober-Kirch (1795–1796)
- Der Bürgergeneral (1793)
- Hermann und Dorothea (1797)
- Die natürliche Tochter (1803)
- Venezianische Epigramme (1795)
- Belagerung von Mainz (1820)
- Campagne in Frankreich 1792 (1822)
- Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter (1794–1795)
Die Auseinandersetzung GOETHEs blieb allegorisch-symbolisch. Er nutzte zwar auch satirische und novellistische Stilmittel, vermittelte jedoch alles in allem ein klassisch geprägtes Gegenbild zur Revolution. Seine ablehnende Haltung der Revolution gegenüber blieb auf die Verurteilung von Gewalt beschränkt.
Die Haltung SCHILLERs
1792 wurde SCHILLER von der Französischen Nationalversammlung die Ehrenbürgerschaft verliehen. Noch schmeichelte ihm diese Auszeichnung. Hatte er aber die Veränderungen in Frankreich anfänglich noch begrüßt, begann mit dem jakobinischen Terror 1793 ein Umdenkungsprozess. Erste Zweifel äußerte er gegenüber CHRISTIAN GOTTFRIED KÖRNER:
„Was sprichst Du zu den französischen Sachen? Ich habe wirklich eine Schrift für den König schon angefangen gehabt, aber es wurde mir nicht wohl darüber, und da ligt sie mir nun noch da.“
(SCHILLER an KÖRNER, 08.02.1793, vgl. PDF "Briefe von Friedrich Schiller an Gottfried Körner")
Einen Höhepunkt der Schreckensherrschaft stellte für SCHILLER die Hinrichtung LUDWIGS XVI. dar.
SCHILLER schrieb außer dem Drama „Wilhelm Tell“ (1804, um den schweizerischen Unabhängigkeitskampf) keine Revolutionsdichtungen. Im Jahr der Uraufführung, 1804, war dieses Drama ein grandioser Erfolg:
Inhalt: Der Reichsvogt Hermann Geßler unterdrückt die drei Kantone Schwyz, Uri und Unterwalden. Als jemand den Burgvogt erschlägt, hilft Wilhelm Tell dem flüchtigen Mörder. Er ist nicht gewillt, sich vor einem an einer Stange befestigten Hut zu verneigen, wie Geßler befahl. Als Feind des Kaisers wird er in Haft genommen. Als Geßler ihn auffordert, mit der Armbrust auf seinen Sohn zu schießen, trifft er den Apfel genau in der Mitte. Tell sinnt nach Rache, in der hohlen Gasse durchbohrt ein Pfeil Tells die Brust des Reichsvogts. Diese Tat ermutigt zur Befreiung des Landes.
GOETHE äußerte sich über die Arbeitsweise SCHILLERs am „Tell“:
„Schiller fing damit an, alle Wände seines Zimmers mit so viel Spezialkarten der Schweiz zu bekleben, als er auftreiben konnte. Nun las er Schweizer Reisebeschreibungen, bis er mit Weg und Stegen des Schauplatzes des Schweizer Aufstandes auf das Genauste bekannt war. Nachdem er alles Material zusammen gebracht hatte, setzte er sich über die Arbeit, und buchstäblich genommen, stand er nicht eher vom Platze auf, bis der „Tell“ fertig war. Überfiel ihn die Müdigkeit, so legte er den Kopf auf den Arm und schlief. Sobald er erwachte, ließ er sich nicht, wie fälschlich nachgesagt worden ist, Champagner, sondern starken schwarzen Kaffee bringen, um sich munter zu halten. So wurde der „Tell“ in sechs Wochen fertig; er ist aber auch wie aus einem Guss.“
(Friedrich Schiller: Wilhelm Tell. Berlin: Cornelsen, 2006, S. 17)
SCHILLER beschäftigte sich ästhetisch mit der Französischen Revolution. Seiner Auffassung nach könnten politische Probleme nicht mehr „durch das blinde Recht des Stärkeren“ gelöst werden, sondern müssten vor dem „Richterstuhl reiner Vernunft“ verhandelt werden. In den „Horen“ veröffentlichte SCHILLER 1795 „Über die ästhetische Erziehung des Menschen, in einer Reihe von Briefen“. Hierin begründete er, dass eine ästhetische Erziehung den Weg zum Vernunftstaat bereiten sollte:
„Der Weg zum Kopf“ müsse „durch das Herz geöffnet werden.“
Ästhetik ist nach seiner Auffassung Vermittlung von Vernunft und Sinnlichkeit.
Nicht durch einen gewaltsamen Umsturz gelange man zum Vernunftstaat, sondern durch evolutionäre Fortentwicklung der Gesellschaft. Deshalb genügt nicht die Reform des Staates. Ziel ist seine allmähliche Auflösung.
Die Annäherung zwischen GOETHE und SCHILLER
Eine Annäherung zwischen GOETHE und SCHILLER erfolgte 1794. Diese war möglich geworden durch die veränderte Haltung SCHILLERs gegenüber der Französischen Revolution. Sowohl GOETHE als auch SCHILLER verhielten sich neutral gegenüber den Veränderungen in Frankreich und Europa. Beide waren der Auffassung, die Entwicklung der Gesellschaft dürfe nicht mit Gewalt in eine neue Richtung gedrängt werden. Diese Haltung begründete ihre Freundschaft.
-
SCHILLERs Vorstellungen von einer ästhetischen Erziehung des Menschen
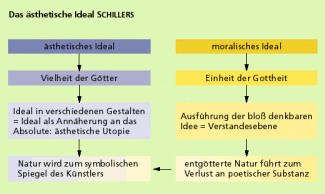
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Hören
- Volltext
- FRIEDRICH STOLBERG
- FRIEDRICH VON GENTZ
- WILHELM LUDWIG WEKHRLIN
- Haltung
- CHRISTOPH MARTIN WIELAND
- Georg Forster
- SCHILLER
- Drama
- Die natürliche Tochter
- Venezianische Epigramme
- Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter
- Das Mädchen von Ober-Kirch
- Ehrenbürgerschaft
- Campagne in Frankreich 1792
- GOETHE
- FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK
- CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL SCHUBART
- CHRISTIAN GOTTFRIED KÖRNER
- KARL AUGUST
- Ästhetik
- Über die ästhetische Erziehung des Menschen
- Belagerung von Mainz
- Vernunft
- Ludwig XVI.
- Frankreich
- Der Bürgergeneral
- Französische Revolution
- Wilhelm Tell
- Primärtext
- Revolutionsdichtung
- Umdenkungsprozess
- jakobinischer Terror
- Koalitionskrieg
- Der Groß-Cophta
- Friedrich Hölderlin
- deutsche Intellektuelle
- Französische Nationalversammlung
- Annäherung
- Hermann und Dorothea
- JOHANN WILHELM VON ARCHENHOLZ

