Viren, Viroide und Prionen – eine Übersicht
Viren, Viroide und Prionen zeigen Teilaspekte des Lebens, sie haben aber keinen eigenen Stoffwechsel und gelten somit nicht als Lebewesen. Sie zeigen Merkmale des Lebens, wenn sie in eine Wirtszelle eingedrungen sind. Eine Infektion mit einem dieser Partikel hat immer eine Erkrankung des Wirts zur Folge.
Obwohl die Zelle die kleinste Grundeinheit eines jeden Lebewesens darstellt und Leben an diese Einheit gebunden ist, gibt es makromolekulare Partikel, die unter bestimmten Bedingungen Merkmale des Lebens aufweisen: Die Viren.
Sie stellen keine eigenständigen Lebewesen dar, zeigen aber Merkmale des Lebens, sobald sie in eine Wirtszelle eingedrungen sind. Die Vermehrung, die Weitergabe genetischer Information und die Bildung bestimmter Stoffwechselprodukte sind solche Lebensmerkmale. Viren sind relativ einfach gebaut und dennoch vielgestaltig in Form und Größe. Das Virusgenom besteht aus DNA oder RNA und ist zumindest von einer Proteinhülle umgeben. Folglich kann man ein solch einfach gebautes Viruspartikel (Virion) auch als Nucleoproteinpartikel auffassen. Komplizierter strukturierte Viren besitzen weitere Hüllen.
Heute sind weit über 2 000 verschiedene Viren bekannt. Geordnet werden sie nach weitgehend formalen Gesichtspunkten. Ein natürliches, auf verwandtschaftlichen Beziehungen beruhendes System existiert bislang nicht. Gebräuchlich ist auch eine Einteilung der Viren nach den Wirten, in denen sie sich vermehren. Prokaryotenviren (Bakteriophagen) lassen sich so von Mykoviren, Pflanzenviren, Insektenviren, Vertebratenviren und anderen abgrenzen.
Der Bakteriophage T4 besteht aus einem polyedrischen Kopf-Capsid, das die DNA und einen komplizierten Schwanzapparat enthält.
Viroide sind infektiöse, nackte RNA-Moleküle. Die Viroid-RNA besteht nur aus mehreren Hundert Nucleotiden. Sind die für die Neubildung der parasitären RNA notwendigen Mechanismen in einer Wirtszelle vorhanden, setzt die Viroid-Synthese ein. Als Viroid-bedingte Krankheiten kennt man u. a. die Kartoffel-Spindelknollensucht, die Eichelfrüchtigkeit der Citrusfrüchte und die Cadang-Cadang-Erkrankung der Kokospalme.
Fehlgestaltete Formen eines körpereigenen Proteins können Ursache ansteckender Krankheiten werden. Von solchen Prionen werden der Rinderwahnsinn (bovine spongiforme encephalopathy = BSE) und eine Variante der menschlichen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (vCJK) hervorgerufen. Der Begriff Prionen steht als Abkürzung für „proteinaceous infectious particles“, was soviel heißt wie proteinartige, infektiöse Partikel (Prion-Proteine, Abkürzung PrP).
Obwohl sich derzeit viele Forscherteams mit dem Prionennachweis und den durch diese Formen ausgelösten Krankheitsverläufen befassen, sind noch viele Fragen offen. Während Viren und Bakterien Genom-Nucleinsäure besitzen, die diesen Krankheiserregern zur Infektiösität verhilft und vor allem die Vermehrung erst möglich macht, besitzen die pathogenen Prionen keine Nucleinsäure. Sie bestehen größtenteils aus normalem zellulärem Protein. Hierbei handelt es sich um ein Oberflächenprotein, das v. a. in den Zellen des zentralen Nervensystems vorkommt und als (C für engl.: cellular) bezeichnet wird.
-
Strukturen von Prionen
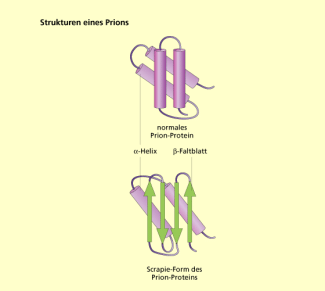
Das abnorme, pathogene Protein wird als (Sc für Scrapie) oder (res für Protease-resistent) bezeichnet. Die Prion-Hypothese geht davon aus, dass einmal gebildetes befähigt ist, bei normalen Molekülen eine Konformationsänderung zu zu veranlassen. Wenngleich dieser Mechanismus der Konformationsübertragung noch nicht sicher bewiesen ist, so bietet er jedoch eine nachvollziehbare Erklärung. Infiziert ein Prion eine Wirtszelle, so verursacht es die Umformung. Das Krankheitsgeschehen nimmt seinen Lauf.
| Krankheit | Abkürzung | Organismus |
| CREUTZFELDT-JAKOB-Erkrankung | CJD | Mensch |
| Neue Variante der CJD | vCJD | Mensch (Überträger: Rind) |
| Kuru-Kuru-Krankheit (Lachkrankheit) | Mensch | |
| Bovine spongiforme Enzephalopathie (Rinderwahnsinn) | BSE | Rind |
| Scrapie (Traberkrankheit) | Schaf, Ziege | |
| Feline spongiforme Enzephalopathie | FSE | Katzen |
Die Creuztfeldt-Jakob-Krankheit (vCJD) wurde erstmals von den beiden deutschen Ärzten HANS-GERHARDT CREUTZFELDT und ALFONS JAKOB beschrieben.
Der weltweit erste BSE-Fall: die „Kuh 133“ erkrankte im Dezember 1984 in Südengland und starb 6 Wochen später an einer spongiformen Enzephalopathie (schwammartigen Gehirnveränderung).

