Phenoplaste und Aminoplaste
Aminoplaste gehören ebenso wie die Phenoplaste zu den ältesten bekannten Kunststoffen. Durch Umsetzung von Methanal mit Phenol erhält man den Phenoplast Bakelit, den ersten synthetisch hergestellten Kunststoff überhaupt. Bakelit ist ein Duroplast, er ist hart, temperatur- und chemikalienbeständig.
Setzt man statt Phenol Harnstoff ein, entstehen die kratzfesten, farblosen, aber hitze- und feuchtigkeitsempfindlichen Harnstoffharze (UF), die überwiegend als Bindemittel für Holz, d. h. als Leim für Sperrholz und Spanplatten, aber auch zur Herstellung von Lackharzen, Schaumstoffen oder Schaltern und Steckdosen verwendet werden.
Aus Methanal und Melamin lassen sich die kochfesten und kaum rissanfälligen, sehr beständigen Melaminharze (MF) gewinnen. Praktische Anwendung finden diese besonders zur Herstellung von Laminaten, Haushaltsgeräten, im Möbelbau oder für bruchfestes Geschirr.
Mit Methanal (Formaldehyd) als Monomer lassen sich durch Polykondensation mehrere Kunststoffsorten herstellen. Diesen ist gemeinsam, dass sie typische Duroplaste sind, sie sind also räumlich vernetzt und somit hart und unschmelzbar (Bild 1).
Unterscheiden lassen sich zwei Arten solcher Formaldehydharze , je nachdem, mit welchen weiteren Monomeren man Formaldehyd reagieren lässt: Setzt man Phenole als zweite Komponente ein, erhält man Phenoplaste, verwendet man Amine, entstehen Aminoplaste. Letztere können ebenfalls in zwei Gruppen eingeteilt werden: Harnstoffharze (UF) erhält man durch die Kondensation von Harnstoff (engl. urea) und Formaldehyd, Melaminharze (MF) durch Einsatz von Melamin anstelle von Harnstoff (Bild 2).
Phenoplaste
Die Kondensationsprodukte aus Phenolen (Hydroxybenzen oder 1,3-Dihydroxybenzen) und Methanal (Formaldehyd) waren die ersten vollsynthetischen Kunststoffe überhaupt.
Der erste echte Kunststoff, Bakelit , wurde1909 von L. H. BAKELAND aus Phenol und Formaldehyd synthetisiert und nach ihm benannt. Man fertigte daraus beispielsweise Radiogehäuse und Steckdoseneinsätze. Aus diesem mit Fasern verstärkten Duroplast wurde auch die Karosserie des Pkw Trabant hergestellt.
Die Bildung von Phenoplasten kann man sich als elektrophile Addition des Methanals an das Phenol vorstellen. Dabei entsteht zunächst ein Benzylalkohol.
![]()
Dieser Benzylalkohol kann selbst wieder ein Phenolmolekül elektrophil angreifen. Unter Abspaltung von Wasser entsteht bei dieser Reaktion das über eine verbundene Dimer:
![]()
-
Eine Steckdose aus Harnstoffharz schmilzt nicht beim Erwärmen.

Heinz Mahler, Berlin
-
Übersicht über die verschiedenen Formaldehydharze
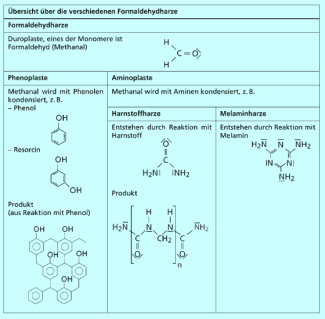
Diese Kondensation kann sowohl an den beiden ortho-Positionen als auch an der para-Position des Phenols erfolgen, was zu einem hohen Vernetzungsgrad des entstehenden Polymers führt.
Phenoplaste sind daher dreidimensional vernetzte, temperatur- und chemikalienbeständige Duroplaste.
![]()
Aminoplaste
Seit Ende der 30er-Jahre werden Aminoplaste in großem Maßstab gefertigt. Gegenüber den eng verwandten Phenolharzen haben sie den großen Vorteil, dass sie bei ähnlichen Eigenschaften keine störende gelbliche bis braune Eigenfarbe besitzen und zudem durch Zusatz von geeigneten Farbstoffen leicht und preiswert eingefärbt werden können.
Man unterscheidet im wesentlichen zwei große Gruppen, die Harnstoffharze (UF) und die Melaminharze (MF).
Harnstoffharze
Harnstoffharze werden durch Umsetzung von überschüssigem Methanal (Formaldehyd) mit Harnstoff (Stoffmengenverhältnis ca. 2:1) gewonnen. Im schwach basischen Milieu wird die Aminogruppe an das Methanal addiert:
![]()
Bei sinkenden pH-Werten wird aus dem Zwischenprodukt 1, das durch Wasserstoffbrückenbindungen stabilisiert wird, Wasser abgespalten. Daher zählt man die Bildung der Aminoplaste auch zu den Polykondensationsreaktionen.
![]()
Die entstehenden Carbo-Kationen reagieren mit nucleophilen N-Atomen, hier also mit den freien im Zwischenprodukt 1, und bilden zunächst lineare Oligomere.
![]()
Bei weiter sinkenden pH-Werten (<5) nimmt die Bildung der Carbo-Kationen deutlich zu, sodass auch bereits substituierte NH-Gruppen in den linearen Ketten erneut substituiert werden können. Dies führt zur dreidimensionalen Vernetzung und Ausbildung eines typischen Duroplasten:
![]()
Melaminharze:
Melaminharze werden auf dem gleichen Weg synthetisiert wie die Harnstoffharze. Man verwendet lediglich Melamin (Triaminotriazin) an Stelle von Harnstoff als Monomer.
![]()
Verwendung:
Die Aminoplaste bilden kratzfeste Kunststoffe mit meist glänzender Oberfläche. Die farblosen, aber hitze- und feuchtigkeitsempfindlichen Harnstoffharze (UF) werden überwiegend als Bindemittel für Holz, d. h. als Leim für Sperrholz und Spanplatten oder als andere Füllstoffe, aber auch zur Herstellung von Lackharzen, Schaumstoffen, Schaltern und Steckdosen verwendet.
Melaminharze (MF) sind zudem kochfest und kaum rissanfällig, also sehr beständig. Praktische Anwendung finden sie besonders zur Herstellung von Haushaltsgeräten und von Laminaten, die als Parkettersatz verwendet werden, außerdem im Möbelbau z. B. als Beschichtung von Küchenfronten und Arbeitsplatten oder auch für bruchfestes Geschirr.

