Leitung in Gasen
Gase sind in der Regel recht gute Isolatoren. Ein Leitungsvorgang in ihnen erfolgt nur dann, wenn durch Ionisation oder Emission frei bewegliche (wanderungsfähige) Elektronen oder Ionen vorhanden sind. Leitungsvorgänge in Gasen sind häufig mit Leuchterscheinungen verbunden. Sie werden deshalb in breitem Umfange in der Beleuchtungstechnik genutzt.
Leitungsvorgänge in Gasen gibt es in Natur und Technik: Blitze, Funkenüberschläge an Schaltern, Leuchtstofflampen, Glimmlampen, Leuchtröhren oder Natriumdampflampen sind Beispiel für das Auftreten oder die Nutzung solcher Leitungsvorgänge. Unter normalen Bedingungen sind alle Gase relativ gute Isolatoren. Wenn ein elektrischer Leitungsvorgang in ihnen erfolgen soll, dann sind wie bei Leitungsvorgängen in anderen Stoffen zwei Voraussetzungen erforderlich:
| Es müssen frei bewegliche (wanderungsfähige) Ladungsträger vorhanden sein: Bei Gasen handelt es sich um positiv geladene Ionen und Elektronen, die in unterschiedlicher Weise erzeugt werden können. |
| Es muss im betreffenden Raumbereich ein elektrisches Feld existieren: Das wird durch Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen zwei Elektroden, der Anode und der Katode, erreicht. |
Der Verlauf des elektrischen Leitungsvorganges in Gasen ist dadurch gekennzeichnet, dass
| sich Ionen und Elektronen im Gas in einer Vorzugsrichtung bewegen; die Geschwindigkeiten können dabei in Abhängigkeit von der angelegten Spannung sehr unterschiedlich sein; |
| die gerichtete Bewegung der Ionen und Elektronen durch Zusammenstöße mit den anderen Teilchen des Gases behindert wird. Charakteristisch ist dabei das Auftreten von Leuchterscheinungen. Es wird also Energie in Form von Licht abgegeben. |
Erzeugung von Ladungsträgern in Gasen
Die für elektrische Leitungsvorgänge in Gasen erforderlichen Ladungsträger können in unterschiedlicher Weise erzeugt werden.
| (1) | Dem Gas wird Energie in Form von Wärme oder Strahlung (kurzwellige und damit energiereiche elektromagnetische Strahlung wie Röntgenstrahlung oder radioaktive Strahlung) zugeführt. Dabei erfolgt eine Ionisierung des Gases. Von den Gasmolekülen werden Elektronen abgespalten. Es sind dann Elektronen und positiv geladenen Gasionen vorhanden (Bild 3), die sich beim Vorhandensein eines elektrischen Feldes gerichtet bewegen. |
| (2) | Wird eine hinreichend große Spannung angelegt und ist der Druck im Gas relativ klein, so werden die stets vorhandenen wenigen Ladungsträger stark beschleunigt. Ihre Energie kann so groß sein, dass sie aus Gasmolekülen Elektronen herauslösen. Ein solcher Prozess geht in der Regel lawinenartig vor sich und wird als Stoßionisation bezeichnet. |
| (3) | Ladungsträger (Elektronen) können auch durch Glühemission oder durch Fotoemission erzeugt werden. |
-
Durch Zufuhr von Energie in Form von Wärme oder Strahlung können Gase ionisiert werden.
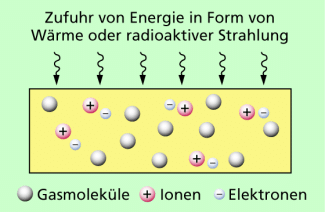
Unselbständige und selbständige Gasentladung
Untersucht man die Verhältnisse in einem Gas genauer, dann ergeben sich charakteristische Zusammenhänge zwischen der anliegenden Spannung und der Stromstärke. Wir betrachten dazu die Vorgänge in einer Gasentladungsröhre, in der ein relativ niedriger Druck herrscht. Das Gas werde nicht beeinflusst.
Legt man eine kleine Spannung an, so fließt ein geringer Strom, der sich aus den zufällig vorhandenen Gasionen und Elektronen zusammensetzt. Bei Vergrößerung der Spannung steigt dieser Strom an (Bild 4) und erreicht schließlich einen Wert, der sich bei weiterer Vergrößerung der Spannung nicht mehr ändert. Das bedeutet: Die Stromstärke wird durch die zufällig vorhandenen Ionen und Elektronen begrenzt. Alle vorhandenen Ladungsträger sind am Leitungsvorgang beteiligt. Man befindet sich in einem Sättigungsbereich (Bild 4). Bis dahin spricht man von einer unselbständigen Gasentladung.
Oberhalb einer bestimmten Grenzspannung erlangen Elektronen eine solche Energie, dass sie von Gasmolekülen weitere Elektronen abspalten können. Es tritt Stoßionisation auf. Man spricht von einer selbständigen Gasentladung. Die Stromstärke steigt meist sehr schnell an, häufig sogar steiler, als es in der grafischen Darstellung gezeichnet ist. Die selbständige Gasentladung ist mit Leuchterscheinungen unterschiedlicher Art verbunden.
Leuchterscheinungen in Gasentladungsröhren
Die in Gasentladungsröhren auftretenden Leuchterscheinungen sind sehr vielfältig. Sie hängen u.a. ab
| von der Art des Gases, | |
| vom Druck im Gas, | |
| von der anliegenden Spannung. |
Legt man an eine Gasentladungsröhre eine Hochspannung an und verringert durch Herauspumpen der Luft allmählich den Druck, so kann man nacheinander charakteristischen Leuchterscheinungen beobachten: Vor der Katode tritt ein Glimmlicht auf. Darüber hinaus leuchtet das Gas im größten Teil der Röhre. Man nennt diese Erscheinung die positive Säule. Ursachen für die Leuchterscheinungen sind die schnellen Elektronen, die mit den Gasmolekülen in Wechselwirkung treten und diese zum Leuchten anregen. Mit Verringerung des Druckes werden die Leuchterscheinungen schwächer, weil sich die Anzahl der Gasmoleküle, mit denen Elektronen in Wechselwirkung treten können, deutlich verringert.
-
Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke bei einer Gasentladungsröhre
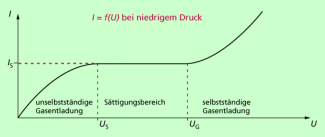
Suche nach passenden Schlagwörtern
- leitende Gase
- interaktive Experimente
- Stoßionisation
- Gasentladungsröhre
- Ionisierung des Gases
- Fotoemission
- elektrische Leitungsvorgänge in Gasen
- positive Säule
- unselbständige Gasentladung
- Ionisation
- Elektronen
- Glimmlicht
- Ionen des Gases
- Glühemission
- Simulation
- selbständige Gasentladung
- Leuchterscheinungen in Gasen
- Gasionen
- elektrische Leitung in Gasen

