Energieerhaltungssatz
In einem abgeschlossenen System ist die Summe aller Energien konstant. Die Gesamtenergie bleibt erhalten. Es gilt:
Bei den vielfältigen Umwandlungen und Übertragungen von Energie, die in Natur, Technik und Alltag vor sich gehen, bleibt die Gesamtenergie immer gleich groß. Sie kann zwar in verschiedenen Formen auftreten, bleibt aber insgesamt immer erhalten, auch wenn sie sich räumlich anders verteilt. Für beliebige Vorgänge in Natur, Technik und Alltag gilt das Gesetz von der Erhaltung der Energie, kurz auch als Energieerhaltungssatz oder als allgemeiner Energieerhaltungssatz bezeichnet. Er lautet:
In einem abgeschlossenen System ist die Summe aller Energien konstant. Die Gesamtenergie bleibt erhalten.
Es gilt:
Unter einem abgeschlossenen System versteht man einen ausgewählten Raumbereich, bei dem kein Stoff- und Energieaustausch mit der Umgebung erfolgt. Welchen Raumbereich man jeweils betrachtet, hängt von den gegebenen Bedingungen und von den Zielen ab, die man verfolgt.
-
Beim Autofahren bleibt die Gesamtenergie gleich groß.

Historisches zum Energieerhaltungssatz
Die ersten Ansätze zur Formulierung des Energieerhaltungssatzes liegen in der Mechanik. Schon GALILEO GALILEI (1564-1642) war wohl von der Energieerhaltung im mechanischen Bereich überzeugt.
Gestützt durch Arbeiten von LEIBNITZ, D. BERNOULLI, EULER und D'ALEMBERT wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Energieerhaltungssatz der Mechanik formuliert. Er wurde aber nicht als allgemeines, auch für andere Bereiche geltendes Prinzip erkannt.
Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts wurden zahlreiche Untersuchungen zu Wärmekraftmaschinen durchgeführt. Die festgestellten Zusammenhänge zwischen Wärme und Arbeit führten schon nahe an den 1. Hauptsatz der Wärmelehre heran.
Wesentlich erschwert wurde die Situation in der damaligen Zeit durch die Bedeutungsvielfalt verschiedener Begriffe. So wurde z. B. der Begriff "Kraft" nicht nur in dem Sinne genutzt, wie wir heute diesen Begriff verwenden. Kraft war teilweise auch die Bezeichnung für mechanische Energie und für Druck.
Die entscheidenden Schritte vollzogen vor allem drei Forscher zwischen 1842 und 1847:
- Der Heilbronner Arzt JULIUS ROBERT MAYER (1814-1878) formulierte 1845 den allgemeinen Energierhaltungssatz.
- Der englische Physiker JAMES PRESCOTT JOULE (1818-1889) bestimmte 1843 den Zusammenhang zwischen der durch elektrischen Strom hervorgerufenen Wärme und der mechanischen Arbeit, die zur Induktion des betreffenden Stromes aufgewandt werden musste. Damit war das mechanische Wärmeäquivalent gefunden.
- Der deutsche Physiker HERMANN VON HELMHOLTZ (1821-1894) formulierte in seiner 1847 erschienenen Schrift "Über die Erhaltung der Kraft" den Energieerhaltungssatz als allgemeingültiges Prinzip. Eine besonders klare und einfache, auf HELMHOLTZ zurückgehende Formulierung lautet:
Energie kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie kann nur von einer Form in andere Formen umgewandelt oder von einem Körper auf andere Körper übertragen werden.
Spezialfälle des Energieerhaltungssatzes
Der allgemeine Energieerhaltungssatz gilt ohne jede Einschränkung für beliebige Vorgänge in abgeschlossenen Systemen. Dabei können auch beliebige Energieformen auftreten.
Manchmal betrachtet man Vorgänge, bei denen nur bestimmte Energieformen eine Rolle spielen, z. B. rein mechanische Vorgänge oder Vorgänge in der Wärmelehre, bei denen nur die thermische Energie von Interesse ist. Für solche speziellen Vorgänge oder Bereiche kann man Spezialfälle des allgemeinen Energieerhaltungssatzes formulieren und anwenden. Wichtige Spezialfälle sind:
- Energieerhaltungssatz der Mechanik: Er kann angewendet werden, wenn rein mechanische Vorgänge vor sich gehen, bei denen nur die potenzielle und die kinetische Energie eine Rolle spielen.
- erster Hauptsatz der Wärmelehre: Durch ihn wird der Zusammenhang zwischen der Änderung der thermischen (inneren) Energie, der Wärme und der mechanischen Arbeit erfasst.
- lenzsches Gesetz: Es beinhaltet eine (indirekte) Aussage über die Energien bei der elektromagnetischen Induktion.
-
Die von J. R. Mayer angegebenen Energieformen (1845)
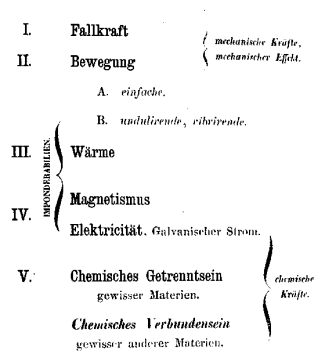
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Hermann von Helmholtz
- allgemeiner Energieerhaltungssatz
- Energieerhaltungssatz
- James Prescott Joule
- abgeschlossenes System
- Spezialfälle des allgemeinen Energieerhaltungssatzes
- Lenzsches Gesetz
- Gesetz von der Erhaltung der Energie
- Julius Robert Mayer
- Energieerhaltungssatz der Mechanik
- Erster Hauptsatz der Wärmelehre

