Energiespeichersysteme
Kein Organismus kann ohne Energie existieren. Wir müssen uns Energie durch Nahrungsaufnahme zuführen, Pflanzen nutzen die Energie des Sonnenlichts. Unsere technischen Geräte können ebenfalls nicht ohne Energie betrieben werden. Sowohl für Organismen als auch für die Funktionsfähigkeit der Geräte ist es wichtig, dass die Energie immer genau dann in ausreichender Menge zur Verfügung steht, wenn sie benötigt wird. Eine Voraussetzung dafür ist die Speicherung von Energie, die in Natur und Technik mithilfe verschiedenster Energiespeichersysteme realisiert wird.
Sowohl für Lebewesen als auch in der Technik ist es wichtig, dass immer ausreichend Energie zur Verfügung steht. Sie muss auch genau dann verfügbar sein, wenn sie benötigt wird.
Energie kann in Energieträgern wie Brennstoffen, Treibstoffen, Nahrungsmitteln, gehobenen und bewegten Körpern, verformten Körpern oder Batterien und Akkumulatoren gespeichert werden. Wichtige Speicherformen sind die chemische Energie, die mechanische Energie und die elektrische Energie.
Besonders günstig sind Energiespeichersysteme, die nicht nur eine bestimmte Energiemenge liefern, sondern die auch immer wieder erneut genutzt werden können, also erneut „geladen“ werden können.
Man kennt eine Vielzahl von Energiespeichern, die man in folgende Gruppen unterteilt:
| 1. | thermische Energiespeicher (Wärmespeicher, z. B. Warmwasserspeicher, Wärmflaschen) | |
| 2. | mechanische Energiespeicher: | |
| Speicher für kinetische Energie (z. B. Schwungräder, strömendes Wasser) | ||
| Speicher für potenzielle Energie (z. B. gespannte Federn, angestautes Wasser, gespannter Flitzbogen) | ||
| 3. | chemische Energiespeicher (z. B. Fette, Kohlenhydrate, Benzin, Batterien, Wasserstoff usw.) | |
Im Folgenden ist das Prinzip einiger chemischer Energiespeicher kurz erläutert. Gemeinsam ist diesen Energiespeichersystemen, das Energie z. B. durch Ausbildung chemischer Bindungen gespeichert wird und durch freiwillig ablaufende chemische Reaktionen freigesetzt wird.
Ein sehr bekanntes derartiges chemisches Energiespeichersystem ist das in der Biologie bedeutsame ADP-ATP-System. Die bei der inneren Atmung (biologische Oxidation) freigesetzte Energie wird mithilfe des organischen Stoffs Adenosintripohosphat (ATP) in Form von chemischer Energie gespeichert. Die Energie wird dazu genutzt, an ein Adenosindiphophat-Molekül (ADP) einen weiteren Phosphatrest anzulagern. Die Energie „steckt“ in der neuen Bindung des gebildeten ATP-Moleküls und wird somit in Form chemischer Energie gespeichert. Die neu geknüpfte Bindung kann leicht wieder gelöst werden, wenn Energie benötigt wird. Durch Abspaltung des Phophatrestes reagiert ATP dabei wieder zum ADP.
-
Ohne elektrische Energie funktionieren diese Geräte nicht.

Boris Mahler, Berlin
In der Technik und im Alltag nutzt man ebenfalls Energiespeichersysteme, um Energie in ausreichender Menge zur Verfügung zu haben, wenn sie benötigt wird, beispielsweise Akkumulatoren . Damit ist es möglich, elektrische Energie ortsunabhängig bereitzustellen.
Akkumulatoren funktionieren durch die Nutzung umkehrbarer elektrochemischer Reaktionen. Beim Laden des Akkumulators wird elektrische Energie in chemische Energie (und z. T. in Wärmeenergie) umgewandelt, beim Entladen chemische Energie in elektrische (und z. T. in Wärmeenergie). Sehr bekannt ist der Bleiakkumulator, der als Autobatterie Verwendung findet (Bild 2).
Energie ist natürlich auch in einfachen Batterien, wie Zink-Kohle-Batterien u. a., in Form von chemischer Energie gespeichert. Auch diese Energie wird bei elektrochemischen Reaktionen in elektrische Energie (und nicht nutzbare Wärmeenergie) umgewandelt. Allerdings lassen sich Batterien anders als Akkumulatoren nicht wieder aufladen.
-
Prozesse beim Entladen und Laden eines Bleiakkumulators
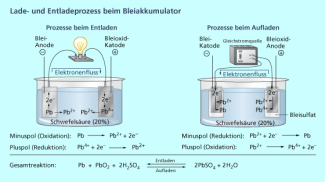
Auf einem anderen Prinzip beruhen sogenannte Latentwärmekissen . Dabei handelt es sich um durchsichtige, meist farblose Gelkissen. Mit ihrer Hilfe kann man u. a. bei Erkrankungen bzw. Schmerzen Linderung erzielen. Um das Wärmekissen zu „starten“, knickt man ein kleines Eisenplättchen im Inneren des Kissens. Das Gel wird fester und das Kissen erwärmt sich auf bis zu +54 °C.
Mit einem einfachen Experiment kann man untersuchen, wie dieses Energiespeichersystem funktioniert. Gibt man beispielsweise 11,1 g Calciumchlorid in 16 g Wasser, erhöht sich die Temperatur um 60 °C. Die Temperaturerhöhung erfolgt, weil in die Kristalle des wasserfreien Calciumchlorids Wassermoleküle eingelagert werden. Der Prozess verläuft also exotherm (Wärmeabgabe). Durch Wärmezufuhr kann das Kristallwasser wieder entfernt werden (endothermer Prozess).
Viele andere Salze können ebenfalls Wasser in ihre Kristalle einlagern, z. B. Natriumacetat. Durch die Wassereinlagerung entsteht Natriumacetattrihydrat (). In den Gelkissen ist eine übersättigte Lösung dieser Verbindung enthalten. Durch das Knicken eines Metallplättchens wird die Lösung angeregt, sofort auszukristallisieren. Da dabei Salzkristalle mit eingelagertem Kristallwasser entstehen, ist der Prozess stark exotherm. Die meiste thermische Energie wird durch die Einlagerung von Kristallwasser freigesetzt.
Um das Wärmekissens wieder benutzen zu können, legt man es in heißes Wasser. Die Energiezufuhr bewirkt eigentlich zwei Prozesse, einerseits die Bildung von wasserfreiem Natriumacetat und dann das Lösen des Salzes in dem freigesetzten Wasser. Der Gesamtprozess ist endotherm.
-
Die Kristallisation des Salzes in den Latentwärmekissen ist ein exothermer Prozess.

Heinz Mahler, Berlin

