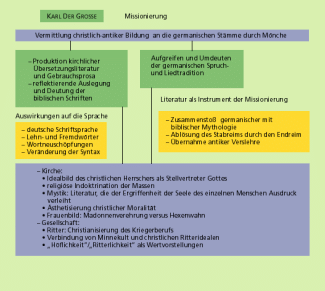Christliche Missionierungsarbeit
In ihren Anfängen ist die deutsche Literatur sprachlich kein einheitliches, sondern vielmehr ein mehrsprachiges Gebilde, wobei das Latein als „Hochsprache“ aller germanischen Stämme fungierte. Kulturell fand durch die Eroberungen die Durchmischung der germanischen Stämme statt. Politisch gesehen ist das spätere Deutschland durch die fränkischen Stämme und deren Herrscher bestimmt.
Unter KARL DEM GROSSEN kam es unter Einbeziehung der christlichen Kirche zur Christianisierung der von ihm eroberten sächsischen Lande. Die in dieser Zeit entstandene Literatur trug Missions- und Bildungscharakter. Im 10. Jahrhundert war die christliche Missionierung auf dem kolonisierten Gebiet der Sachsen beendet. Die deutsche Literatur im 10.–12. Jahrhundert wurde vor allem in Klöstern geschrieben.
Die Anfänge
Deutschland gibt es um 500–750 noch nicht. Es gibt auch noch keine deutsche Nation oder gar einen deutschen Nationalismus. (Die Begriffe Nation und Nationalismus sind dem bürgerlichen Zeitalter vorbehalten.) Vielmehr leben germanische Stämme mehr oder weniger friedlich nebeneinander in einem Territorium, das im Osten etwa bis zur Elbe reichte.
Die deutsche Literatur ist in ihren Anfängen auch sprachlich kein einheitliches, sondern vielmehr ein mehrsprachiges Gebilde, wobei das Latein als „Hochsprache“ aller germanischen Stämme fungierte und sich so ab 800 n.Chr. eine eigenständige religiöse (lateinische) Literatur entwickelte. Man fasst heute jedoch
- unter „althochdeutsch“ urfränkische, alemannische und bairische Schriften des 8.–11. Jahrhunderts zusammen,
- während „altniederdeutsch“ fast synonym für altsächsisch gebraucht wird.
Kulturell fand durch die Eroberungen KARLs DES GROSSEN und anderer Regenten die Durchmischung der germanischen Stämme statt. Die Westgoten eroberten u. a. lateinisches Sprachgebiet. Die Franken eroberten u. a. langobardisches, alemannisches und bairisches Gebiet sowie Gallien. Politisch gesehen ist das spätere Deutschland durch die fränkischen Stämme und deren Herrscher bestimmt.
KARL DER GROSSE
Das Auftauchen althochdeutscher Texte fällt ungefähr zusammen mit der Regierungszeit KARLs DES GROSSEN (747–814).
Im 8. Jahrhundert hatten die Franken bereits ganz Gallien sowie die alemannischen und bairischen Gebiete erobert.
Der Erfolg der Gebietseroberungen KARLs gründete sich auf dessen Taktik, berittene Krieger einzusetzen, denen er nach erfolgreichem Angriff ein Lehen versprach. Diese „miles“ wurden als Ritter die Stütze des Mittelalters.
Mit der Eroberung der sächsischen Lande reichte das Frankenreich ab 804 von der Atlantikküste im Westen bis zur Elbe im Osten (Einen Überblick über die geschichtlichen Ereignisse seit 500 n.Chr. bietet die Animation 1). Die christliche Kirche sollte nun zur Umerziehung (Christianisierung) der eroberten Gebiete beitragen. Dazu versammelte KARL die geistige Elite um sich:
- ALKUIN (Angelsachse) traf 781 während einer Romreise mit KARL DEM GROSSEN zusammen und begleitete ihn anschließend nach Aachen,
- EINHARD (Franke) kam als Schüler ALKUINs an KARLs Hof,
- PETRUS VON PISA (Langobarde) unterrichtete KARL als Diakon in Latein,
- PAULUS DIAKONUS (Langobarde) verfasste in Aachen die Geschichte der Langobarden („Historica Langobardum“),
- auch die Angelsachsen OSULF und FRIDUGIS sowie der Ire JOSEPH wirkten in KARLs Sinne.
KARL selbst war ein gebildeter Mensch, er reformierte die lateinische Schriftsprache (karolingische Minuskel) und ließ „Scriptorien“ (Schreibstuben) einrichten, in denen man Handschriften vervielfältigte. Am Hofe des Kaisers wurde eine Akademie gegründet, es entstanden Bibliotheken, antike Autoren wurden rezipiert. Lateinische Texte wurden in germanische Dialekte übersetzt. Die entstehende Literatur trug somit Missions- und Bildungscharakter: KARL DER GROSSE bediente sich der Volkssprache, um die Christianisierung in seinem Reich durchzusetzen. Nicht zufällig sind die ältesten Schriften Glossare, Glaubensbekenntnisse, Beichtformeln und Übersetzungen des Vaterunser. Dabei riss die Verbindung zur ursprünglichen germanischen Dichtung ab.
LUDWIG DER FROMME
LUDWIG DER FROMME (778–840) ließ eine Sammlung germanischer Heldenlieder vernichten, die KARL hatte anlegen lassen. Der Vertrag von Verdun von 843 läutete die Reichsteilung und damit das Entstehen der deutschen und französischen Nation ein. Auf dem Gebiet des späteren Deutschlands lässt sich eine Zweiteilung in hoch- und niederdeutsche Dialekte beobachten, die bis heute anhält.
Christliche Missionierung und deutsche Literatur im 10.–12. Jahrhundert
Die christliche Missionierung auf dem kolonisierten Gebiet der Sachsen war im 10. Jahrhundert beendet. Seit dem 9. Jahrhundert, verstärkt im 11. und 12. Jahrhundert drangen deutsche Armeen in slawisches Siedlungsgebiet östlich der Elbe vor. Durch eine Fülle kleinräumiger Einzelinitiativen wurden die slawischen Völker immer weiter in Richtung Osten verdrängt bzw. gewaltsam christianisiert. So drangen die Sachsen 908 bis nach Thüringen vor und in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts unterwarf sich auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern PRIBISLAV, der Obodrit, dem Sachsenkönig HEINRICH DEM LÖWEN sowie JAROMAR, der Rane, dem Dänenkönig WALDEMAR im Osten. Aus den westlichen Gebieten Deutschlands drangen nun Siedler (Bauern, Handwerker, Priester) nach Osten, gründeten Städte, Klöster und Dörfer. Die slawische Urbevölkerung wurde assimiliert (vermischte sich mit den Deutschen).
Die deutsche Literatur im 10.–12. Jahrhundert wurde vor allem in Klöstern geschrieben. OTTO I. (936–973) und sein Enkel OTTO III. (983–1002) bemühten sich, die von KARL begonnene Kultur- und Bildungspolitik fortzusetzen, ein höfisches Zentrum jedoch konnten sie nicht wieder errichten. Statt dessen übernahmen diese kulturellen Aufgaben die lothringischen Klöster, die Klöster von St. Gallen in der heutigen Schweiz und Weißenburg im heutigen Elsass (Heimatkloster von OTFRIED VON WEISSENBURG, des ersten namentlich bekannten Dichters deutscher Sprache) sowie das Kloster Fulda.
774 hatte KARL DER GROSSE das Kloster Fulda direkt dem König unterstellt. Die katholische Kirche führte zu Beginn des 11. Jahrhunderts eine Mönchsreform (die cluniazensisch-gorzische Reform) durch. Diese sah die strenge Zucht der Mönche nach den alten unveränderten Benediktinerregeln vor. Neben absoluter Enthaltsamkeit verfolgte die Reform die Ausschaltung allen Laieneinflusses.
HEINRICH II. (1002–1024) unterstützte die hauptsächlich vom 910 gegründeten französischen Kloster Cluny ausgehenden Bestrebungen, das reine, asketische Klerikale über das profane, niedere Weltliche in der Literatur zu stellen. Die Kirche reinigte sich auf diese Art und Weise von allem Weltlichen. Das geistliche Leben wurde zur reinsten Form des christlichen Menschen erhoben. Ideologisch wurde diese Sicht durch die Lehren ABÄLARDs (1079–1142, Vater der Scholastik) und BERNHARDs VON CLAIRVAUX (1091–1153, der einflussreichste geistige Leiter seiner Zeit) sowie durch die Ideen der Scholastik materialisiert.
Deutsche Texte werden von nun an selten innerhalb kirchlicher Schriften. Die Selbstaufgabe in Gott wurde in lateinischer Sprache gepriesen. Diese Art Weltverneinung schloss jedoch auch das Laientum (gebildetes Rittertum, Vasallen, Ministerialen) ein und führte einerseits zu dem Bestreben, das Heilige Land von den Muslimen zu befreien (Kreuzzüge), andererseits zu dem Phänomen des Minnesanges im Hochmittelalter.
Die Standespyramide des Mittelalters
Die Standespyramide entschied über den Grad an persönlichen Freiheiten. Die Menschen des Mittelalters zeichnete eine tiefe Frömmigkeit aus. Sie verstanden sich als Teil einer ganzen, größeren göttlichen Ordnung. Die Aufgaben waren den Ständen von Gott gegeben:
- An der Spitze der Pyramide stand als geistliches und weltliches Oberhaupt der König bzw. der Kaiser (Beschützer des Glaubens). Der geistliche und weltliche Adel stand ihm zur Seite. Sie bildeten als „betende Gruppe“ und „kämpfende Gruppe“ den ersten und zweiten Stand.
- Handwerker, Kaufleute, Bauern, Hörige und Leibeigene bildeten als „arbeitende Gruppe“ gemeinsam den dritten Stand. Handwerker und Kaufleute in den Städten standen noch über den Bauern. Nahezu rechtlos waren die Hörigen und Leibeigenen.
Die Angehörigen des dritten Standes waren in der Regel Analphabeten und beherrschten nur die Volkssprache. In den Liturgien wurde jedoch lateinisch gepredigt. Das Evangelium konnte deshalb lediglich in Bildern vermittelt werden (Fresken und Gemälde in den Kirchen „erzählten“ die Geschichte des Christentums).
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Heinrich II.
- deutsche Literatur im 10.-12. Jahrhundert
- urfränkisch
- JAROMAR
- FRIDUGIS
- HEINRICH DEM LÖWEN
- althochdeutsche Texte
- betende Gruppe
- Standespyramide
- Joseph
- Kloster
- OTFRID VON WEISSENBURG
- Scriptorien
- ABÄLARD
- cluniazensich-gorzische Reform
- Franken
- Vertrag von Verdun
- Ritter
- kämpfende Gruppe
- slawische Völker
- Mittelalter
- Otfried von Weißenburg
- WALDEMAR
- Otto III.
- OSULF
- germanische Heldenlieder
- bairisch
- KARL DER GROSSE
- alemannisch
- BERNHARD VON CLAIRVAUX
- Dialekte
- Hochsprache
- Volkssprache
- deutsche Literatur
- Minnesang
- Latein
- OTFRIED VON WEISSENBURG
- Althochdeutsch
- katholische Kirche
- christliche Kirche
- PAULUS DIAKONUS
- germanische Stämme
- deutsche Nation
- Gallien
- KARL DER GROßE
- Mönchsreform
- LUDWIG DER FROMME
- Laientum
- karolingische Minuskel
- ALKUIN
- arbeitende Gruppe
- christliche Missionierung
- Altniederdeutsch
- PETRUS VON PISA
- Christianisierung
- EINHARD
- Kloster Fulda
- Otto I.
- PRIBISLAV
- Sachsen
- langobardisch
- Animation
- Eroberung der sächsischen Lande