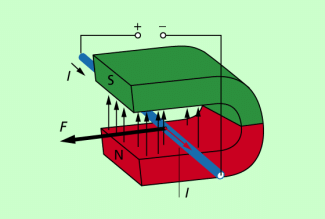Lorentzkraft
Auf alle geladenen Teilchen oder Körper, die sich in einem magnetischen Feld bewegen, wirkt eine Kraft. Diese Kraft bezeichnet man nach dem niederländischen Physiker HENDRIK LORENTZ (1853-1928), der sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts näher untersucht hat, als Lorentzkraft.
Berechnungen zur Lorentzkraft sind mitunter recht kompliziert, weil die Lorentzkraft als vektorielle Größe sowohl von der Bewegungsrichtung und dem Betrag der Teilchengeschwindigkeit als auch von der Größe und Richtung des Magnetfeldes abhängt.
Für den Sonderfall, dass Bewegungsrichtung und magnetische Feldlinien senkrecht zueinander stehen, kann man den Betrag der Lorentzkraft relativ einfach experimentell untersuchen und berechnen.
Auf alle geladenen Teilchen oder Körper, die sich in einem magnetischen Feld bewegen, wirkt eine Kraft. Diese Kraft bezeichnet man nach dem niederländischen Physiker HENDRIK LORENTZ (1853-1928), der sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts näher untersucht hat, als Lorentzkraft.
Die Rechte-Hand-Regel (UVW-Regel)
Berechnungen zu Richtung und Betrag der Lorentzkraft sind mitunter recht kompliziert, weil die Lorentzkraft als vektorielle Größe sowohl von der Bewegungsrichtung und dem Betrag der Teilchengeschwindigkeit als auch von der Stärke und Richtung des Magnetfeldes abhängt. Die Richtung dieser Kraft wird mithilfe der Rechte-Hand-Regel (UVW-Regel) ermittelt. Da die im Leiter bewegten Ladungsträger nicht unmittelbar zu sehen sind, hat man bei der Anwendung dieser Regel die Definition der Stromrichtung zu beachten. Daher gilt:
- Der Daumen der rechten Hand zeigt vom positiven zum negativen Stromanschluss des Leiters (Ursache U).
- Der Zeigefinger der rechten Hand zeigt in Richtung des magnetischen Feldes, das stets vom Nord- zum Südpol orientiert ist (Vermittlung V).
- Der Mittelfinger der rechten Hand weist in Richtung der Lorentzkraft (Wirkung W).
Die Lorentzkraft auf geladene Teilchen
Für den Sonderfall, dass Bewegungsrichtung und magnetische Feldlinien senkrecht zueinander stehen, kann man den Betrag der Lorentzkraft relativ einfach experimentell untersuchen. Dabei stellen sich folgende Abhängigkeiten heraus:
Die Lorentzkraft ist umso größer, je stärker das äußere Magnetfeld ist. Die Stärke des Feldes charakterisiert man mithilfe der magnetischen Flussdichte B:
F ~ B
Die Lorentzkraft ist proportional zur Geschwindigkeit v des geladenen Teilchens:
F ~ v
Die Lorentzkraft ist proportional zur Ladung Q des bewegten Teilchen:
F ~ Q
Fasst man alle Proportionalitäten zusammen, dann erhält man als Berechnungsgleichung für den Betrag der Lorentzkraft:
Die Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter
Ein Stromfluss in einem elektrischen Leiter ist gleichbedeutend mit der Bewegung von Ladungsträgern. Befindet dich dieser Leiter in einem äußeren Magnetfeld, dann muss demzufolge eine Lorentzkraft auf ihn wirken (Bild 1).
Anders als bei der Lorentzkraft, die auf einen einzelnen Ladungsträger wirkt, befinden sich im stromdurchflossenen Leiter stets sehr viele Elektronen gleichzeitig im magnetischen Feld. Die Lorentzkraft ist deshalb die Summe aller Teilkräfte auf die einzelnen Elektronen. Befindet sich der Leiter senkrecht zu den magnetischen Feldlinien und bezeichnet N die Anzahl aller geladenen Teilchen, die sich gleichzeitig innerhalb des Feldes aufhalten, gilt für den Betrag der Lorentzkraft:
Die Stromstärke gibt an, wie viele Ladungen pro Zeit durch den Leiterquerschnitt fließen:
Multipliziert man diese Gleichung mit der Länge des Leiters l und beachtet, dass die Elektronengeschwindigkeit v im Leiter konstant ist und deshalb gilt, ergibt sich:
Achtung!: Das Zeichen I hat eine unterschiedliche physikalische Bedeutung. Es bedeutet zum einen die Länge des Leiters und zum anderen die elektrische Stromstärke.
Den Ausdruck darf man also durch den Ausdruck ersetzen. Damit ergibt sich für die Lorentzkraft auf das gerade Leitungsstück:
Man beachte: In dieser Gleichung bedeutet ein l die Länge des Leiterteilstückes, das sich innerhalb des magnetischen Feldes befindet.