Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu
* 18.01.1689 Château de la Brède (bei Bordeaux)
† 10.02.1755 Paris
Der französische Philosoph, Staatsrechtler und Historiker CHARLES DE MONTESQUIEU gilt mit seiner Theorie der Gewaltenteilung als Stammvater europäischer Demokratie. Er legte seine Gedanken in seinem Hauptwerk „De l'esprit des lois“ dar. Dabei hatte er besonderes Augenmerk auf die „politische Freiheit des Bürgers.“ Er definiert diese als „jene Ruhe des Gemüts, die aus dem Vertrauen erwächst, das ein jeder zu seiner Sicherheit hat“. Ziel politischer Herrschaft muss also die Sicherung der bürgerlichen Freiheit sein: Kein Träger einer Gewalt dürfe deshalb zugleich Träger einer anderen sein, denn sonst könne dieser die Gewalt tyrannisch einsetzen.
CHARLES DE MONTESQUIEU war ein französischer Philosoph, Staatsrechtler und Historiker. Er gilt als Begründer der politischen Theorie der horizontalen Gewaltenteilung und damit als Stammvater europäischer Demokratie.
„Etwas ist nicht recht,
weil es Gesetz ist,
sondern es muss Gesetz sein,
weil es recht ist.“ (MONTESQUIEU).
Kindheit und Jugend
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BRÈDE ET DE MONTESQUIEU, stammt aus dem hohen Amtsadel, der „noblesse parlementaire“:
„Parlements“ waren im Frankreich des 18. Jahrhunderts regionale Verwaltungs-, Gerichts- und Selbstverwaltungseinrichtungen.
CHARLES-LOUIS war der Sohn von JACQUES DE SECONDAT und seiner Frau MARIE-FRANÇOISE DE PESNEL am 18. Januar 1689 im Schloss La Brède bei Bordeaux geboren. Der Name BRÈDE verweist auf die Herrschaft der Barone DE SECONDAT bei Bordeaux, MONTESQUIEU dagegen auf eine Baronie bei Agen, die einem Vorfahren CHARLES-LOUIS von der Königin JEANNE D´ALBERT VON NAVARRA verliehen worden war. König HEINRICH IV. hatte sie in eine Baronie erhoben.
CHARLES-LOUIS wurde zunächst auf Schloss La Brède von Privatlehrern unterrichtet. Als er sieben Jahre alt war, starb seine Mutter.
Im Jahr 1700 wechselte er auf die Schule der Oratorianer in Juilly bei Paris. Bis 1708 studierte er Jura und humanistische Philosophie in Bordeaux und Paris. Danach ließ er sich als Advokat in Paris nieder.
Richter in Bordeuax
1713 starb sein Vater und MONTESQUIEU kehrte nach Bordeaux zurück.
Ab 1714 war er Parlamentsrat (Richter) am Gericht („Parlement“) von Bordeaux. 1715 heiratete er JEANNE DE LARTIGUE. 1716 erbte er das Amt des Gerichtspräsidenten („président à mortier“) von seinem Onkel JEAN-BAPTISTE DE SECONDAT und übte es bis 1726 aus.
1721 erschien seine satirische Betrachtung der französischen Gesellschaft der Zeit LUDWIGs XIV. unter dem Titel „Les Lettres Persanes“ (deutsch: „Persische Briefe“). Es ist eine fiktive Korrespondenz zweier Perser, Usbek und Rica, die Europa, resp. Frankreich zwischen 1712 und 1720 bereisen. MONTESQUIEU hatte sich beim Schreiben an den „Lettres provinciales“ seines Landsmannes BLAISE PASCAL orientiert. Während jedoch PASCAL einen jungen, naiven Adligen aus der Provence, Louis de Montalte, seine „lettres“ verfassen ließ, führte MONTESQUIEU die kritische Sicht Außereuropäischer auf abendländische Kultur und abendländisches Denken vor.
Auf Reisen
1726 verkaufte MONTESQUIEU das Amt als Gerichtspräsident und trat eine ausgedehnte Reise durch Deutschland, Ungarn, Italien, die Schweiz, Holland und England an.
1728 wurde MONTESQUIEU Mitglied der im Jahre 1635 von Kardinal RICHELIEU gegründeten Académie Française. Diese bestand aus 40 Personen, aus Schriftstellern, Dichtern, Wissenschaftlern, Politikern usw. Bedingung für die Aufnahme war und ist, dass sie sich um die französische Sprache und Literatur verdient gemacht haben sollten. Sie werden deshalb auch „die 40 Unsterblichen“ (nach der Inschrift auf dem Siegel der Akademie „À l'immortalité“ = für Unsterblichkeit) genannt.
1730, auf seiner Reise durch England, wurde MONTESQUIEU Mitglied der „Royal Society“.
1734 erschien die geschichtsphilosophische Schrift „Considérations sur la grandeur et la décadence des Romains“ in Amsterdam, in der MONTESQUIEU den Aufstieg und den Untergang des römischen Reiches beschreibt. FRIEDRICH DER GROSSE glaubte in diesem Werk,
„die Quintessenz all dessen, was sich der menschliche Geist an Philosophischem über das römische Staatsleben ausdenken kann“
zu erkennen. MONTESQUIEU selbst ging es um die immerwährenden Prinzipien menschlichen Handelns, darum, dass Geschichte durch Belehrung zum eigenen Handeln anregt. Am „abgeschlossenen System“ Römisches Reich exemplifizierte er die Fallstudie eines politischen Systems, konnte er die Grundgesetze menschlicher Gesellschaft verallgemeinern.
In seinem Hauptwerk „De l'esprit des lois" („Vom Geist der Gesetze“, 1748) nahm MONTESQUIEU einen bereits von JOHN LOCKE („Two treatises on government“, 1690) skizzierten Grundgedanken auf, den der Gewaltenteilung in:
- Gesetzgebung (Legislative),
- Staatsgewalt (Exekutive) und
- Rechsprechung (Judikative).
MONTESQUIEU ging von der naturwissenschaftlichen Deutung gesellschaftlicher Gesetze aus. Er unterscheidet zum einen:
- lois principales (hauptsächliche Gesetze) und zum anderen
- lois accessoires (nebensächliche Gesetze).
Daneben gibt es für ihn das Begriffspaar der
- lois naturelles (Naturgesetze) und der
- Vernunftgesetze.
-
Einfaches Schema der Gewaltenteilung
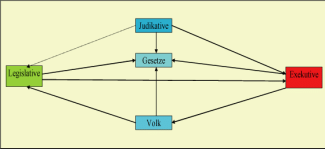
Natur der Dinge
Gesetze ergeben sich aus der Natur der Dinge (Nature des choses).
- Charakter der Gesetze hängt vom jeweiligen politischen System ab,
- Einfluss der Natur eines Landes (Boden, Klima, Geographie) und der Natur seiner Bewohner (Sitte, Bildung, Religion) auf den Charakter der Gesetze,
- immanente Faktoren (z. B. Absicht des Gesetzgebers).
MONTESQUIEU unterscheidet in „Naturen“ und „Prinzipien“:
| „Naturen“ | |
| Republik (Demokratie und Aristokratie) | Herrschaft des Volkes: kleine Staaten |
| Monarchie | nach feststehenden Gesetzen regiert: mittlere Staaten |
| Despotie (z. B. französischer Absolutismus) | nach Laune und Willkür regiert: große Staaten |
| „Prinzipien“ (Handlungsprinzipien) | |
| Republik |
|
| Monarchie | Ehre (honneur), Streben nach Ansehen und Anerkennung |
| Despotie | Furcht (crainte) Gehorsam wird erzwungen) |
MONTESQUIEU sagt von den Engländern, sie hätten es „in drei wichtigen Dingen von allen Völkern der Welt am weitesten gebracht:
- in der Frömmigkeit,
- im Handel und
- in der Freiheit“. (Esprit des lois Buch XX cap. 7).
Dabei legte er besonderes Augenmerk auf die „politische Freiheit des Bürgers.“ Er definiert diese als „jene Ruhe des Gemüts, die aus dem Vertrauen erwächst, das ein jeder zu seiner Sicherheit hat.“ Ziel politischer Herrschaft muss also die Sicherung der bürgerlichen Freiheit sein: Kein Träger einer Gewalt dürfe deshalb zugleich Träger einer anderen sein, denn sonst könne dieser die Gewalt tyrannisch einsetzen.
„Die politische Freiheit ist nur unter maßvollen Regierungen anzutreffen. Indes besteht sie selbst in maßvollen Staaten nicht immer, sondern nur dann, wenn man die Macht nicht missbraucht. Eine ewige Erfahrung lehrt jedoch, dass jeder Mensch, der Macht hat, dazu getrieben wird, sie zu missbrauchen. Er geht immer weiter, bis er an Grenzen stößt. ... Damit die Macht nicht missbraucht werden kann, ist es nötig, durch die Anordnung der Dinge zu bewirken, dass die Macht die Macht bremse.“
„Sobald in ein und derselben Person oder derselben Beamtenschaft die legislative mit der exekutiven Befugnis verbunden ist, gibt es keine Freiheit. Es wäre nämlich zu befürchten, dass derselbe Monarch oder derselbe Senat tyrannische Gesetze erließe und dann tyrannisch durchführte. Freiheit gibt es auch nicht, wenn die richterliche Befugnis nicht von der legislativen und von der exekutiven Befugnis geschieden wird. ... Alles wäre verloren, wenn ein und derselbe Mann bzw. die gleiche Körperschaft entweder der Mächtigsten oder der Adligen oder des Volkes folgende drei Machtvollkommenheiten ausübte: Gesetze erlassen, öffentliche Beschlüsse in die Tat umsetzen, Verbrechen und private Streitfälle aburteilen.“
Letzte Lebensjahre
Nach seinem Erscheinen löste sein Werk „De l'esprit des lois“ in Paris, vor allem in den Kreisen der Jansenisten und an der theologischen Fakultät der Sorbonne, heftige Debatten aus. MONTESQUIEU gab daraufhin seine Verteidigungsschrift, die „Défense de l´esprit des lois“ heraus.
1751 wurde MONTESQUIEUsS Buch auf den Index der verbotenen Bücher des Vatikan gesetzt, d. h., für die katholische Welt galt es nun als ketzerisch. Papst PAUL IV. hatte erstmals 1557 den „Index Librorum Prohibitorum“ erstellen lassen, auf dem Schriften PIETRO ARETINOS, JEAN-JAQUES ROUSSEAUs, HEINRICH HEINEs, GIORDANO BRUNOs u. v. a. standen. Der letzte Index wurde erst 1966 erstellt und dann von der katholischen Glaubenskongregation aufgehoben.
MONTESQUIEUs Buch konnte der katholische Index nichts anhaben: Es übte danach noch großen Einfluss auf die Verfassung der USA (1776) und die französische Revolution (1789) aus. Allerdings erlebte der Autor dies nicht mehr. MONTESQUIEU starb am 10. Februar 1755 in Paris.

