Embryonalentwicklung bei Tieren
Die Embryonalentwicklung umfasst die Entwicklung der Eizelle bis zum Schlüpfen oder der Geburt des Jungtiers.
Sie lässt sich in vier Abschnitte gliedern: Furchung, Keimblattbildung, Organbildung und histologische Differenzierung.
Die einzelnen Phasen können ganz unterschiedlich ablaufen und sind von der inneren Strukturierung der Eizelle abhängig.
Die Anlage von Organen und Organsystemen erfolgt oft in Segmenten.
Die Embryonalentwicklung der Tiere beginnt in den meisten Fällen mit der Befruchtung einer Eizelle durch ein Spermium eines Individuums der gleichen Art. (Es kommen allerdings neben der bisexuellen Fortpflanzung bei Tieren auch ungeschlechtliche Fortpflanzung sowie Pseudogamie (Merogamie) und Parthenogenese (Jungfernzeugung) vor.)
Dabei kommt es zunächst zur Zellverschmelzung (Plasmogamie) und später zur Verschmelzung der Zellkerne (Karyogamie). Das Resultat ist eine Zygote . In der nun entwicklungsbereiten Eizelle sind nicht alle Bestandteile gleichmäßig verteilt. Daher sind die Eizellen immer mehr oder weniger polar strukturiert. Besonders eindrucksvoll zeigt sich diese Polarität, wenn eine Ungleichverteilung des Dotters vorliegt. Ist der Dotter, wie beispielsweise bei Amphibien oder Vögeln, an einer Seite des Eies konzentriert, so spricht man von vegetativem Pol. Der Kern liegt dann, je nach Dottermenge, näher an der anderen Seite, dem animalen Pol.
Gastrulation
Den nun folgenden Entwicklungsschritt, der in der folgenden Abbildung anhand von vier prinzipiellen Varianten veranschaulicht wird, bezeichnet man als Gastrulation (Becherkeimbildung). Dabei erfolgt die Ausbildung der Keimblätter.
Die meisten total äqualen und total inäqualen Furchungen führen zu einer Blastula mit animalem und vegetativem Pol. Bei diesen Typen wird der vegetative Pol während der Gastrulation nach innen eingestülpt oder umwachsen. Dabei entsteht der Urmund. Einfach gebaute Vielzeller, wie die Hohltiere (z. B. Süßwasserpolyp, Ohrenqualle), geben Zellen aus dem Ektoderm in das Blastocoel ab, die sich dann zum Entoderm organisieren. Mit der Stufe der Gastrula ist ihre Organisationsstufe bereits erreicht.
Bei discoidal gefurchten Eiern, wie z. B. bei Vögeln, entsteht das Entoderm durch intensive Teilungsvorgänge einer Zellschicht vom Randbereich der Keimscheibe. Sie wächst zwischen Blastoderm und Dotter.
Auch die Blastodermzellen des superficiellen Furchungstyps (z. B. Insekten) sondern sich im typischen Fall in zwei Gruppen. Die eine zeigt geringe Teilungsaktivität und wird zur Hüllanlage . Die sich lebhafter teilende Zellgruppe stellt die Vorkeimanlage dar. Dann überwachsen die Randbereiche den zentralen Bereich der Vorkeimanlage und schließen diesen ein. Beide Gewebsschichten vereinigen sich zur Keimanlage.
Mit Ausnahme der Schwämme und Hohltiere schließt sich nun die Bildung des dritten Keimblatts, des Mesoderms, an. Dabei werden entweder vom Entoderm oder vom Ektoderm Zellen in den Gewebszwischenraum abgegeben, die sich nachfolgend zur dritten Gewebsschicht organisieren. Bei allen Tieren, die ein Larvenstadium durchlaufen (z. B. Würmer, Krebse, Manteltiere, Lurche, Insekten) findet eine Metamorphose statt.
Die Neuordnung der Keimbereiche führt auch zu neuen Nachbarschaften von Zellgruppen. Dieser Kontakt hat wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung. Im Folgenden sollen wesentliche Entwicklungsschritte exemplarisch anhand der Amphibien dargestellt werden.
Neurulation
Nach der Gastrulation grenzt sich auf dem Ektoderm die schuhsohlenförmige Neuralplatte ab. Durch Einsenkung entsteht daraus das Neuralrohr (Neurulation, siehe Übersicht). Vom Mesoderm wird zwischen Neuralrohr und Urdarm eine längliche Struktur, die „Rückensaite“ (Chorda dorsalis) gebildet. Aus diesem ursprünglichen Stützorgan werden bei den Wirbeltieren später die Zwischenwirbelscheiben.
Das an die Chorda seitlich anschließende Mesoderm bildet die Ursegmente, die auch als Somiten bezeichnet werden. Ventral (bauchseitig) entstehen aus dem Mesoderm die ungegliederten Seitenplatten, in deren Inneren die sekundäre Leibeshöhle gebildet wird, das Coelom.
Seitenplatten und Somiten sind durch mesodermale Zellen miteinander verbunden, die im mikroskopischen Bild wie Stielchen aussehen. Man bezeichnet diese Verbindungen daher als Somitenstiel. Mit diesen Entwicklungen ist die Neurulation abgeschlossen.
Metamerie
Mit der Bildung der Somiten deutet sich ein Charakteristikum aller Tiere mit sekundärer Leibeshöhle an: Außere und innere Organsysteme werden ursprünglich segmental angelegt. Man bezeichnet eine solche Segmentierung des Körpers als Metamerie . Mit Ausnahme der Ringelwürmer und der Gliederfüßer ist sie später äußerlich meist nicht mehr und innerlich nur begrenzt erkennbar.
Bei den Wirbeltieren lässt sich die Metamerie noch gut an der Wirbelsäule mit den Rippen und an der Zwischenrippenmuskulatur erkennen, die aus den Somiten hervorgehen.
Nach der Neurulation gliedert sich der längliche Embryo in die drei Abschnitte Kopf, Rumpf und Schwanz. Dabei wächst die Schwanzknospe an der Urmundseite aus. Der Urmund wird daher zum After und der Mund muss neu gebildet werden. Organismen mit dieser Entwicklungsform bezeichnet man deshalb als Neumundtiere oder Deuterostomier. Neben den Chordatieren zählen die Stachelhäuter zu dieser Organismengruppe.
Plattwürmer, Fadenwürmer, Ringelwürmer, Gliederfüßer und Weichtiere legen den After neu an und behalten den Urmund. Sie werden als Urmundtiere oder Protostomier bezeichnet.
Dieser ontogenetische Unterschied hat auch Auswirkungen auf die Grundorganisation: Bei den Protostomiern wird der Nervenstrang bauchseitig („Bauchmark“), das Herz rückenseitig angelegt, bei den Deuterostomiern ist dies umgekehrt.
-
Neurolation und Mesodermentwicklung bei Amphibien
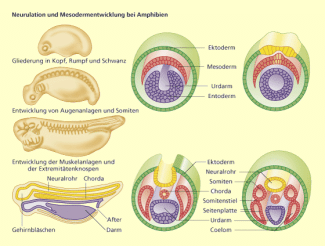
Am Beispiel des Lanzettfischchens kann man das gut erkennen.
Das bis zu 6 cm große Lanzettfischchen lebt, eingegraben in den sandigen Untergrund, als Strudler in den Flachwasserzonen der europäischen Meere. Es repräsentiert die Grundgestalt der Chordatiere . Hier lässt sich nicht nur im Bereich der Muskulatur, sondern auch am Kiemendarm und am Herz-Kreislauf-System die Metamerie deutlich erkennen. Der Grundaufbau entspricht dem Schlüpfstadium eines Amphibienkeims.
Neben der hier dargestellten gibt es im Tierreich viele weitere Neurulations- und Organbildungsvarianten.
Die anschließende Übersicht soll veranschaulichen, welche Organbildungen sich von den jeweiligen Keimblättern herleiten.
Ektoderm: | Oberhaut mit Drüsen und Anhangsgebilden (z. B. Nägel), Anfang und Ende des Darmkanals mit Drüsen, Nervensystem mit Sinneszellen, Außenskelett |
Entoderm: | Mitteldarmepithel mit Drüsen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Schwimmblase, Lungen, Kiemen, Schilddrüse |
Mesoderm: | Innenskelett, Muskeln, Bindegewebe, Blutgefäßsystem, Lymphsystem, Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane |
-
Lanzettfischchen
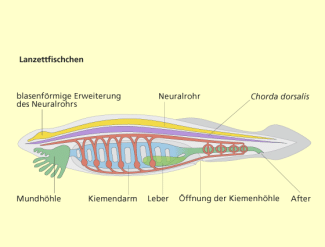
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Video
- Karyogamie
- Seitenplatten
- Zygote
- sekundäre Leibeshühle
- Somiten
- Keimblütter
- Wirbeltieren
- Vorkeimanlage
- Ektoderm
- Gastrulation
- Entoderm
- vegetativem Pol
- Neurulations- und Organbildungsvarianten
- Deuterostomier
- Chordatiere
- animalen Pol
- Neuralrohr
- Hüllanlage
- Metamorphose
- Mesoderms
- Somitenstiel. Metamerie
- Dotter
- Neurulation
- Protostomier
- Plasmogamie
- Coelom
- Embryonalentwicklung
- Ursegmente
- Tiere
- Neuralplatte

