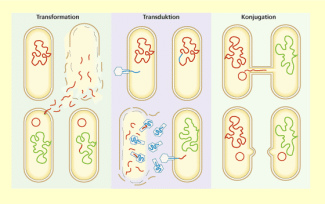Fortpflanzung und Vermehrung der Prokaryoten
Bei Prokaryoten kommen neben der Zellteilung verschiedene Formen des Austauschs von genetischem Material vor, auch zwischen verschiedenen „Arten“.
Die geschlechtliche Fortpflanzung geschieht artenbezogen, beispielsweise über einen Generationswechsel oder über die räumliche und zeitliche Trennung von Plasma- und Kernverschmelzung.
Fortpflanzung und Vermehrung der Prokaryota erfolgen überwiegend durch Zweiteilung, seltener durch multiple Zellteilung.
Es war LOUIS PASTEUR (1822-1895), der die spontane Entstehung von Bakterien (Urzeugung) widerlegte.
Nachdem die DNA verdoppelt wurde, bleiben die Kopien an benachbarten Stellen der Membran gebunden. Nun wächst die Membran zwischen den Anheftungsstellen, wodurch die DNA-Ringe weiter auseinanderrücken. Wenn die Bakterienzelle durch Wachstum ca. das Doppelte ihrer ursprünglichen Länge erreicht hat, schnürt sich die Plasmamembran nach innen ein und zwischen den Tochterzellen wird eine Zellwand gebildet. Die Zellen können nach der Teilung in mehr oder weniger festen Ketten verbunden bleiben.
-
Zellteilung einer Bakterienzelle
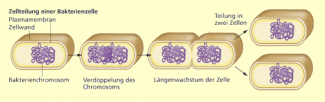
Zur Überdauerung ungünstiger Lebensbedingungen können manche Bakterien Dauerzellen oder Sporen ausbilden. Diese können endogen (in einer Mutterzelle) oder exogen (als Abschnürungen nach außen) gebildet werden.
Auch prokaryotische Organismen verfügen über die Möglichkeit, Erbinformation zu rekombinieren. Dafür gibt es drei Möglichkeiten.
1. Bei der Transformation nehmen kapsellose Bakterien nackte DNA auf. Dafür besitzen sie häufig spezielle Membran-Transportproteine, die selektiv Erbinformationen eng verwandter Arten erkennen und ins Zellinnere transportieren. Das fremde Gen wird dann durch einen DNA-Austausch, der dem Crossing-over entspricht, ins Bakterienchromosom eingefügt.
2. Bei dem als Transduktion bekannten Mechanismus übertragen Viren (Bakteriophagen) Nucleinsäureabschnitte von einer Wirtszelle auf eine andere: Gelegentlich wird ein kleines Fragment der Wirts-DNA statt der oder zusätzlich zu der Viren-DNA in ein Capsid eingebaut und später in ein anderes Bakterium injiziert. Danach kann die injizierte Bakterien-DNA in das Bakteriengenom eingebaut werden.
-
Sporenbildung bei Bakterien
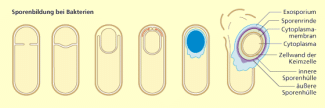
3. Konjugation ist der direkte Transfer genetischen Materials zwischen zwei Bakterienzellen, die vorübergehend über Cytoplasmabrücken (sogenannte Pili) miteinander in Verbindung stehen. Eine Bakterienzelle fungiert als Spender, die andere als Empfänger. Es können kurze DNA-Ringe (Plasmide), aber auch Teile des großen Ringgenoms oder sogar das ganze Ringgenom übertragen werden. Genübertragung ist auch zwischen verschiedenen Bakterienarten möglich (horizontaler Genaustausch).
Man fasst die verschiedenen Formen des Genaustauschs bei Prokaryoten als Parasexualität zusammen.
-
Rekombinieren der Erbinformation bei Prokaryoten