Genexpression bei Hefepilzen (Experimentalanleitung)
Der Begriff Genexpression umfasst ganz allgemein die Realisierung der genetischen Information der DNA durch die Umwandlung und Herstellung funktioneller Proteine, d. h. genauer formuliert die im Verlauf der Transkription stattfindende Bildung von tRNA, rRNA und mRNA sowie die darauf aufbauende Translation reifer mRNA-Sequenzen zu Proteinen. Ein wesentlicher Teil dieses Prozesses ist die Proteinbiosynthese, die als Endergebnis die lebensnotwendigen Proteine bereitstellt. Die vollständige Ausprägung der genetischen Information führt zur Entwicklung des speziellen Phänotyps eines Organismus. Die Ausbildung eines Merkmals wird meist durch mehrere miteinander in Wechselwirkung stehende Gene kontrolliert und hängt darüber hinaus zum Teil auch von Umwelteinflüssen ab. Die nachfolgend beschriebenen Experimente dienen dem Nachweis einer speziell ausgeprägten Nahrungsbevorzugung bei Hefepilzen.
Experiment 1
Versuchsziel: Halbquantitativer Nachweis der Vergärbarkeit verschiedener Kohlenhydrate durch Saccharomyces cerevisiae (Bäckerhefe)
Vorbemerkung: Hefepilze vergären nur diejenigen Kohlenhydrate, die in die Zellen permeieren und dort enzymatisch zerlegt werden können. Bevorzugt sind dies Glucose, Fructose und Saccharose. (Deshalb muss beim Backen von Hefeteig immer eine Prise Zucker dazugegeben werden.) Disacchararide werden im Allgemeinen erst nach vorangegangener Hydrolyse vergoren.
Geräte und Chemikalien:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Durchführung: Proben von jeweils 2 g Hefe werden mit 20 ml der zu testenden Zuckerlösung so lange geschüttelt, bis sich eine homogene Suspension bildet. Diese Aufschlämmungen werden in Gärröhrchen nach EINHORN – oder pneumatisches Auffangen als Ersatzlösung – umgefüllt, die 30-60 Minuten im Wärmeschrank bei 35-40 °C inkubiert werden.
Beobachtung: Ablesen der jeweils gebildeten CO2-Menge.
| Kohlenhydrate | in ml |
| Saccharose Maltose Glucose Fructose Galactose Mannose Xylose Arabinose | 4,5 0 5,5 5,0 0 0 0 0 |
Auswertung: Entsprechend der Vorbemerkung existiert hinsichtlich der zu erwartenden Experimentalergebnisse eine Erwartungshaltung. Zu beobachten ist die unterschiedliche Intensität der Gasentwicklung bei den einzelnen Mono- bzw. Disaccharidlösungen. Wenn keine Gärröhrchen nach EINHORN zur Verfügung stehen, können die Hefesuspensionen auch im 50 ml-Erlenmeyerkolben angesetzt und das Kohlenstoffdioxid kann über ein Gasableitungsrohr im graduierten Halbmikroreagenzglas pneumatisch aufgefangen werden.
Eine klare Bevorzugung von Glucose, Fructose und Saccharose ist nachgewiesen worden. Es werden also die Zucker vergoren, die auch unter natürlichen Bedingungen als Substrat in Erscheinung treten. Andere Kohlenhydrate würden unter Umständen nach einer Adaptationszeit durch Aktivierung ruhender Gene permeiert bzw. enzymatisch zerlegt werden können.
Experiment 2
Versuchsziel: Qualitativer Nachweis der Induktion der Enzymsynthese am Beispiel der Galactosidase von Saccharomyces cerevisiae (Bäckerhefe)
Vorbemerkung: Das Experiment schließt sich inhaltlich nahtlos an das Vorexperiment an. Bis dato ruhende Gene der Hefepilze sollen aktiviert werden, das heißt die Zellen stellen ihren Energiestoffwechsel auf ein neues Gärungssubstrat (hier Galactose) um. Mit diesem sind sie vorher nicht konfrontiert worden, haben jedoch die „enzymatische Technologie“ genetisch abgespeichert. Durch die Referenz der „nichttrainierten“ Hefe wird die Induktion des GAL-Operons eindrucksvoll nachgewiesen.
Ein Arabinose-Operon wurde bisher nur bei Escherichia coli nachgewiesen. Die Hefepilze verfügen nicht über die entsprechenden Synthesewege, um dieses Monosaccharid für den katabolen Stoffwechsel nutzen zu können, sodass das Ergebnis mit Nährlösung II dem der Referenzkultur entspricht.
Allgemein werden die Enzyme für den Abbau anderer Kohlenhydrate nur dann bereitgestellt, wenn extrem niedrige Glucose-Konzentrationen vorliegen bzw. – wie im Experiment – Glucose völlig fehlt.
-
Expression des genetischen Materials
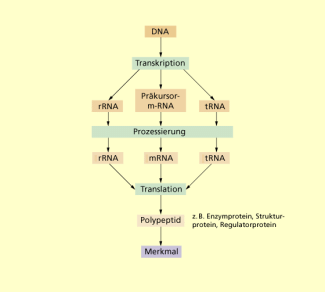
Geräte und Chemikalien:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Durchführung:
- Etwa 10 g frische Bäckerhefe werden in 100 ml Nährlösung I in einem Erlenmeyerkolben suspendiert und anschließend belüftet sowie bei 30 °C temperiert. Die Belüftung der Nährlösung im Erlenmeyerkolben erfolgt mittels Ausströmerstein, Schlauchverbindung, durchbohrtem Stopfen und Aquarienpumpe. Für die Temperierung stellt ein Kalorimeter die sinnvollste Lösung dar, allerdings könnte ein Wasserbad auch über eine regulierbare Aquarienheizung temperiert werden. Mit den Bedingungen Nährsubstrate, Sauerstoff und Optimaltemperatur wird eine möglichst hohe Stoffwechselaktivität der Hefepilze sichergestellt.
- Nach 24 Stunden wird die Hefe abgetrennt, mit Wasser gewaschen und erneut nach Arbeitsschritt 1 behandelt. Das Abtrennen und Waschen der Hefe im 24 Stunden-Rhythmus erfolgt am effektivsten mittels Wasserstrahlpumpe, Saugflasche und Filternutsche oder Fritte, da es sich bei der Hefesuspension um eine extrem feinkörnige Aufschlämmung handelt, würde einfache Filtration nicht zu verwertbaren Ergebnissen führen.
- Wiederholung der Prozedur nach den Arbeitsschritten 2 und 1.
- Parallel dazu wird mit Nährlösung II nach den Schritten 1 bis 3 verfahren.
- Ein Gramm der so vorbehandelten, gewaschenen Hefen wird in 10 ml Galactose-Lösung suspendiert, in ein Gärröhrchen nach EINHORN gefüllt und bei 30 °C temperiert.
- Ein drittes Gärröhrchen wird als Referenz analog, allerdings mit unbehandelter Bäckerhefe beschickt.
- Nach 60 Minuten erfolgt die Messung der Gasentwicklung.
Beobachtung: Ablesen der jeweils gebildeten
Probe 1: Etwa 3,5 ml wurden in einer Stunde gebildet.
Probe 2: Es ist keine Gasentwicklung zu beobachten.
Probe 3: Es ist keine Gasentwicklung zu beobachten.
Auswertung:
Interpretation der unterschiedlichen Gärungsaktivität.
Die experimentell nachgewiesene unterschiedliche Gärungsaktivität der drei Ansätze kann nur damit erklärt werden, dass die 72-stündige Kultivierung in Nährlösung I zu einer Induktion der Enzymsynthese geführt hat. Die unbehandelte Hefe in Gärröhrchen III kann dagegen das dargebotene Substrat Galactose nicht verwerten. Gärröhrchen II zeigt, dass die Enzyme für einen Arabinoseabbau von Saccharomyces cerevisiae nicht synthetisiert werden können.
Analyse anhand des OPERON- Modells nach F. JACOB und J. MONOD
Warum kann die qualitative Bestimmung der Gärungsaktivität beider Hefesuspensionen auch über den pH-Wert vorgenommen werden?
Da das bei der Gärung frei werdende teilweise in der wässrigen Lösung des Gärröhrchens reagiert,
kann die gestiegene Hydronium-Ionen-Konzentration mittels Indikator (z. B. Bromthymolblau) nachgewiesen und als Indiz für die Gärungsaktivität der Hefepilze gewertet werden.

