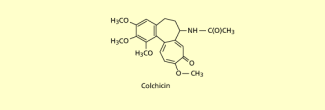Herbstzeitlose, Colchicin
Das Gift der Herbstzeitlosen, das Colchicin, hemmt die Ausbildung von Mikrotubuli, da es sich an ihre Bausteine (Tubulindimere) bindet. Dadurch werden Mitose bzw. Meiose gehemmt. Dies ermöglicht die Herstellung von Karyogrammen (bildliche Darstellung der sortierten Chromosomen) mit Metaphasechromosomen. Das Gift kann aber auch zum Auslösen von Polyploidiemutationen in der Pflanzenzüchtung genutzt werden.
Die Herbstzeitlose Colchicum autumnale (auch unter der Bezeichnung Herbstlilie, Wiesensafran oder Giftkrokus bekannt) gehört als einkeimblättrige Pflanze der Ordnung der Lilienartigen an. Hier bildet sie mit einigen anderen Gattungen eine eigene Familie, die Herbstzeitlosengewächse. Der Gattungsname Colchicum geht auf Colchis – eine Landschaft an der Ostküste des Schwarzen Meers – zurück, wo nach der griechischen Mythologie einst die Giftmischerin MEDEA lebte und ihr Vorkommensgebiet liegt.
Die Entwicklung der Pflanze verläuft recht ungewöhnlich. Während im Herbst die hell-lila gefärbten Blüten durch das Erdreich brechen, entwickeln sich die länglichen Laubblätter erst im nächsten Frühjahr. Die Samen reifen im Juni. Die zwischen 5 und maximal 40 cm hohe Pflanze bevorzugt nährstoffreiche, feuchte Wiesen. Seit 1561 wird sie auch in Gärten als Zier- und Arzneipflanze kultiviert.
Die gesamte Pflanze ist stark giftig. Alle Pflanzenteile, vor allem jedoch Samenschale und Knolle, enthalten rund 20 verschiedene Colchicumalkaloide. Die Samen und Knollen wurden schon im Altertum als Arznei verwendet. Neben starken Nebenwirkungen konnte eine Überdosierung der Droge (letale Dosis: ca. 20 mg Colchicin; etwa 5 g Herbstzeitlosensamen) schnell zum Tod durch Atemlähmung und Kreislaufversagen führen. Hauptalkaloid ist das Colchicin. Die Wirkung des Gifts beruht auf der Bindung des Colchicins an Tubulindimere, die Bausteine von Mikrotubuli. Dadurch werden alle zellulären Prozesse gehemmt, an denen Mikrotubuli beteiligt sind, wie beispielsweise die Zellteilung, Sekretionsprozesse und die Bewegung von Zellen oder Zellbestandteilen.
Colchicin, das 1819 von PIERRE JOSEPH PELLETIER (1788-1842) und JOSEPH BIENAIMÈ CAVENTOU (1795-1877) entdeckt wurde, ist als gutes Gichtmittel bekannt und wirkt – in kleinen Mengen – schmerzstillend und entzündungshemmend. Eine hohe Dosis hat nach Stunden Erbrechen, Übelkeit und Lähmungserscheinungen zur Folge. Bei der Behandlung von Gicht und rheumatischen Beschwerden hemmt das Gift die Phagocytoseaktivität von Fresszellen (Granulocyten, Monocyten) des Immunsystems und stoppt somit die Auslösung eines Gichtanfalls. Die eigentlichen Ursachen der Gicht werden hierdurch jedoch nicht beseitigt.
Als Zytostatikum, d. h. zellteilungshemmendes Medikament bei Leukämie, kam Colchicin zeitweilig zu Einsatz.
Heute liegen die wichtigsten Anwendungsgebiete des Gifts im Bereich der Genetik, da es die Ausbildung des Spindelapparats insbesondere der Spindelfasern hemmt. Zur Anfertigung von Karyogrammen (bildliche Darstellungen der sortierten Chromosomen) in der genetischen Diagnostik werden Mitosen von sich teilenden Zellen gestoppt. Metaphasechromosomen können präpariert und untersucht werden.
Bei vollständiger Hemmung der Mitose zerfallen die Metaphasechromosomen in ihre beiden Chromatide. Der Transport an die Zellpole wird jedoch unterbrochen. Dadurch fällt die Anaphase der Mitose aus. In der Telophase werden alle Einchromatid-Chromosomen von einer neuen Kernmembran umschlossen, eine Zellteilung findet nicht statt. Das Erbmaterial innerhalb des Zellkerns hat sich verdoppelt. Eine Endomitose fand statt, die zu polyploiden Chromosomensätzen führte. Diese zellteilungshemmende Wirkung findet wegen zu hoher Toxizität des Colchicins in der Krebstherapie keine Anwendung. In der Pflanzenzüchtung wird dieses Verfahren zur Polyploidisierung (Erzeugung polyploider Rassen) jedoch häufig genutzt, da Colchicin für Pflanzen relativ ungiftig ist.
-
Strukturformel des Colchicins