Nitrifizierende Bakterien
Der Stickstoffkreislauf ist einer der großen Stoffkreisläufe in der belebten Natur. Wichtige Stickstoffverbindungen für die Organismen sind Ammonium bzw. Ammoniak. Diese Verbindungen können von vielen Bakterien und grünen Pflanzen als Stickstoffquelle genutzt werden, um Proteine, Nucleinsäuren und andere stickstoffhaltige Substanzen aufzubauen. Damit stellen diese die Stickstoffquelle für tierische Organismen dar, denn Tiere können nur organisch gebundenen Stickstoff verwerten.
Obwohl die Atmosphäre zu ca. 80 % aus Stickstoff besteht, können ihn die meisten Pflanzen in der dort vorliegenden Form nicht aufnehmen. Stickstoff-fixierende Bakterien können aus diesem freien Stickstoff Ammonium-Ionen herstellen. Durch Nitrifikation mit Hilfe anderer Bakteriengruppen entstehen so die für Pflanzen lebenswichtigen Nitrat-Ionen und können von ihnen in Proteine und andere stickstoffhaltige organische Verbindungen umgewandelt werden. Laubfall, Ausscheidungsprodukte von Tieren und abgestorbene Lebewesen bringen die organischen Stoffe wieder in den Boden wo sie mineralisiert werden. Der Kreislauf ist geschlossen, wenn durch Denitrifikation wieder Luftstickstoff entsteht.
Bei der Stickstoff-Fixierung wird gasförmiger Stickstoff aus der Luft zu Ammonium-Ionen reduziert und in den Stickstoffkreislauf eingeschleust. Zu dieser Fixierung sind nur bestimmte Bakterien in der Lage. Würde es diese Bakterien nicht geben, käme der Stickstoffkreislauf zum Erliegen. Das Leben auf der Erde würde zugrunde gehen. Alle Lebewesen hängen von diesen Bakterien genau so ab, wie von der Fotosynthese. Es existieren zwei Formen dieser Bakterien, eine davon lebt im Boden (Azobacter). Diese Bakterien sind in der Lage, molekularen Stickstoff zu assimilieren. Sterben sie ab, wird dieser Stickstoff als Ammoniak dem Boden zugeführt.
-
Stickstoffkreislauf

Die zweite Bakterienform lebt symbiotisch in Pflanzenwurzeln von Leguminosen (Hülsenfrüchten), (Rhizobien oder Knöllchenbakterien) und wandelt ebenfalls Stickstoff in Ammoniak um. Sie binden den Stickstoff aus der Luft und überführen ihn in lösliche, für die Pflanzen verwertbare Stickstoffverbindungen. Diese Stickstoff-Fixierung kann unter aeroben und anaeroben Bedingungen stattfinden.
Verantwortlich für die Umwandlung des Luftstickstoffs ist das Enzymsystem Nitrogenase. Für die Fixierung sind sehr viel Energie und Wasserstoff als Reduktionsäquivalente notwendig. Der Multienzymkomplex Nitrogenase reduziert den Stickstoff schrittweise zu Ammoniak. Die Bilanz dieses schrittweisen Prozesses lässt sich in der Reaktionsgleichung zusammenfassen.
-
Stickstoff-Fixierung durch das Enzymsystem der Nitrogenase
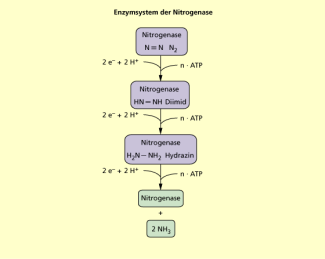
Unter den im Boden lebenden Stickstoff-Fixierern gibt es die Knöllchenbakterien Rhizobium und Bradyrhizobium. Es sind gramnegative stäbchenförmige, begeißelte Bakterien mit später unregelmäßigen Formen. Sie leben in Symbiose mit Schmetterlingsblütengewächsen (Leguminosen) und benötigen Sauerstoff für ihren Atemstoffwechsel. Die Symbiose der Knöllchenbakterien stellt das wichtigste System der Stickstoff-Fixierung dar. Durchschnittlich können sie jährlich 100 kg Luftstickstoff pro Hektar (unter guten Bedingungen 250 - 600 kg) binden. Ihr Vorkommen reicht von der subarktischen über die gemäßigte bis zur tropischen Klimazone.
Zieht man nach der Ernte z. B. eine Wurzel einer Erbsenpflanze oder vom Klee, sieht man knollenförmige Verdickungen.
In diesen Wurzelknöllchen befinden sich die Bakterien. Zunächst dringen die Stäbchen über die Wurzelhaare ein und bilden einen Infektionsschlauch. Durch Vermehrung und Vergrößerung entstehen Wucherungen, die das Wurzelgewebe infizieren.
Im ausgewachsenen Zustand verschwindet die Stäbchenform, unregelmäßig geformte Zellen (Bakteroide) liegen im Zytoplasma der Wurzelrinde. Die Symbiose zwischen Pflanze und Knöllchenbakterien besteht im Stofftausch. Die Pflanze liefert organische Stoffe wie Zucker, Aminosäuren und andere organische Säuren. Die Bakteroide bilden aus Stickstoff Ammoniak, der den Pflanzen als Nährstoff dient.
Da die Bakteroide sich im Cytoplasma der Wirtszellen befinden, stellen diese aus Ammoniak das Glutamin und Asparagin her, das in dieser Form in den Stoffwechsel gelangt.
Die große Bedeutung der Knöllchenbakterien liegt in ihrer Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der Verbesserung stickstoffarmer Böden. Ebenso tragen sie in der Pflanzensymbiose zur Synthese von für Mensch und Tier wichtigen Proteinen bei, ohne dass diese Leistung durch zusätzliche kostspielige Düngeprozesse unterstützt werden muss.
Die Fähigkeit der Rhizobien zur Stickstofff-Fixierung ist von Interesse bei der Entwicklung von Stickstoff fixierenden Pflanzen. Allerdings sind an diesem komplexen Prozess mehrere Gene beteiligt. Bisher ist es noch nicht gelungen, mit gentechnischen Verfahren Stickstoff fixierende Pflanzen zu entwickeln.
Man nimmt an, dass pro Jahr ca. 200 Mio. t Stickstoff fixiert werden. Den größten Teil fixieren die Knöllchenbakterien (100-300 kg pro Hektar und Jahr), einen geringeren Teil die frei lebenden Bakterien (1-3 kg/ha/Jahr).

