Phytohormome (Pflanzenhormone)
Phytohormone sind von Pflanzen synthetisierte Stoffe, die schon in kleinen Mengen steuernd auf pflanzliche Entwicklungs- und Differenzierungsvorgänge einwirken, z. B. auf Keimung, Wachstum, Samenreife, Blattabwurf, Blütenbildung, Differenzierung und Verzweigung. Es gibt viele Parallelen zur Wirkung von Hormonen bei den Tieren aber auch Unterschiede. So lässt sich bei Pflanzen im Gegensatz zu Tieren häufig keine Trennung von Bildungs- und Wirkungsort beobachten. Auch gibt es bei Pflanzen keine fest umrissenen Hormondrüsen. In unterschiedlichen Geweben und Organen können Phytohormone gegensätzliche Reaktionen hervorrufen. Indolessigsäure fördert z. B. das Streckungswachstum in Sprossen, hemmt aber in gleicher Konzentration das Wachstum der Wurzeln.
Bei der Phytohormonforschung spielen Mutanten, die für bestimmte Hormone nicht sensibel sind, eine große Rolle. Auf diese Art und Weise konnten Phytohormonrezeptoren festgestellt werden.
Die Hormonwirkung beruht auf der Aktivierung bestimmter Gene. Die biochemischen Reaktionsketten, die dieser Aktivierung zugrunde liegen, sind in vielen Fällen noch nicht vollständig aufgeklärt.
Man unterscheidet Auxine, Cytokinine, Gibberelline, Ethylen, Brassinosteroide, Oxylipine (Fettsäurederivate) und Peptide (Systemin, Phytosulfokine).
Phytohormone (Pflanzenhormone, Pflanzenwuchsstoffe) sind von Pflanzen synthetisierte Stoffe, die ähnlich wie die Hormone der Tiere und des Menschen in kleinen Mengen steuernd auf Entwicklungsvorgänge (z. B. auf Keimung, Wachstum, Samenreife, Blattabwurf, Blütenbildung, Differenzierung und Verzweigung) einwirken.
Nach der Entdeckung des wachstumsfördernden Effekts von Auxin (Indol-3-essigsäure: IES, indole acetic acid: IAA) bei Pflanzen wurde der Begriff von den tierischen Hormonen übernommen. Im Gegensatz zu den Tieren haben Pflanzen jedoch keine echten, deutlich abgegrenzten Hormondrüsen. Vielmehr können Phytohormone in vielen Bereichen des Vegetationskörpers gebildet werden. Häufig wird ein bestimmtes Gewebe erst durch Umwelteinflüsse zur Synthese dieser Stoffe angeregt. Auch können Phytohormone in denselben Zellen oder Geweben wirken, in denen sie produziert werden. Stärker als tierische Hormone kontrollieren und regulieren Pflanzenhormone Wachstums- und Differenzierungsprozesse. Viel seltener greifen sie an den ausdifferenzierten Geweben an (z. B. Kontrolle der Schließzellenbewegung durch Abscisinsäure). Ein weiterer Unterschied ist, dass Pflanzenhormone oft nur sehr kurze Transportwege bis zu ihrem Wirkungsort zurücklegen müssen. Oft erfolgt dies einfach durch Diffusion. Hinzu kommt, dass Pflanzenhormone häufig sehr verschiedene Wirkungen hervorrufen, je nachdem, in welchen Geweben und Organen sie auftreten.
-
Wirkung von Phytohormonen und ähnlichen Signalstoffen (Überblick)
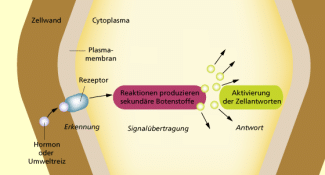
Auxine
Auxin war das erste bekannte Pflanzenhormon. Die Forschungen, die zur Entdeckung dieses Wachstumsfaktors führten, begannen mit Untersuchungen von CHARLES und FRANCIS DARWIN um 1880. Sie untersuchten die lichtabhängige Krümmung von Haferkoleoptilen (Koleoptile = Keimscheide, Hülle um den Spross einer keimenden Graspflanze). Das Versuchsobjekt wurde von anderen Forschern beibehalten. Die chemische Natur des Auxins wurde um 1935 aufgeklärt.
Auxine sind Phytohormone, die das Streckungswachstum von Zellen und damit das Längenwachstum von Sprossachsen und Wurzeln fördern, in hohen Konzentrationen jedoch hemmen. Unterschiedliche Auxinverteilungen im Sprossquerschnitt führen zu Krümmungswachstum. Das bekannteste Auxin ist die ß-Indolyl-Essigsäure (IES). Verwandte Stoffe sind Phenylessigsäure (Tabak), Indolacrylsäure und halogenierte Derivate der Indolylessigsäure (bei Hülsenfrüchten) sowie synthetische Auxine – z. B. 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D) –, die zeitweilig als Herbizide eine wichtige Rolle spielten.
![]()
-
Wirkung von Pflanzenhormonen
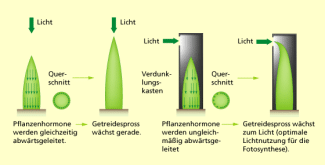
Walther-Maria Scheid
Auxine werden in Bildungsgeweben (Meristemen) der Sprossspitze (Apikalmeristem) synthetisiert. Die Biosynthese kann von der Aminosäure L-Tryptophan ausgehen, außerdem vom Indol bzw. dem Indol-3-Glycerolphosphat.
Über größere Entfernungen kann IES mit dem Assimilatstrom des Phloems transportiert werden. Der polare Transport des Auxins von der Sprossspitze zur Wurzel läuft von Zelle zu Zelle ab, im Parenchym oder (bei zweikeimblättrigen Bedecktsamern) speziell in den Zellen der Leitbündelscheiden. Dieser relativ langsame Transport führt zu einem Konzentrationsgradienten, der für zahlreiche morphogenetische (formbildende) Prozesse der Pflanze verantwortlich ist.
Im Einzelnen kann man folgende Wirkungen unterscheiden:
| |
| |
| |
| |
| |
|
Die auxinbedingte Förderung des Streckungswachstums kommt durch Einwirkung des Auxins auf die Zellwand zustande. Auxin bewirkt, dass vermehrt Wasserstoff-Ionen über das Plasmalemma nach außen in die Zellwand abgegeben werden. Diese Ansäuerung führt dazu, dass Enzyme (z. B. Expansin) aktiv werden, die die Wasserstoffbrücken-Bindungen im Zellwandbereich lösen. So wird die plastische Verformbarkeit der Zellwand erhöht und die Einlagerung neuer Zellwandbausteine erleichtert.
-
IES-stimulierte Zellstreckung
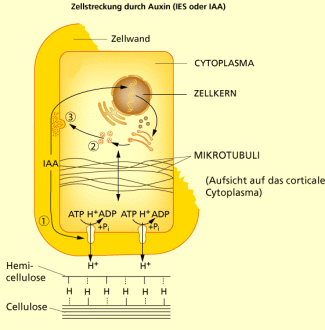
Auxinregulierte Vorgänge laufen unter Veränderung der Genexpression ab. Es gibt Mutationen, die zu einem Verlust der Reaktionsfähigkeit von Zellen auf Auxin führen (AXR-Mutanten, „auxin resistent“).
Cytokinine
Cytokinine sind chemische Abkömmlinge des Purins. Sie fördern das Teilungswachstum von Zellen. Als Biotest auf die Cytokininwirkung dient der Tabakmark-Thallustest: Auf sterilem Nährboden ist die Gewichtszunahme solcher Thalli proportional dem Cytokiningehalt. Allerdings wirkt Cytokinin nur, wenn auch Auxin vorhanden ist. Durch entsprechende Hormongaben kann man Kalli zur Regeneration von Wurzeln (höhere Auxinkonzentration) und zur Regeneration von Sprossen (höhere Cytokininkonzentration) stimulieren.
Cytokinine spielen auch als Gegenspieler der Apikaldominanz eine Rolle. So dürfte das starke Auswachsen von Seitentrieben bei der Hexenbesenbildung infolge des Befalls durch den Schlauchpilz Taphrina betulina eine Konsequenz der Cytokininproduktion dieses Pilzes sein.
![]()
Weitere Wirkungen der Cytokinine:
| |
| |
|
Manchmal kann man auf abfallenden, sich verfärbenden Blättern grüne Inseln erkennen, die dadurch zustande kommen, dass parasitische Pilze oder Bakterien Cytokinine ausschütten, die an diesen Stellen den Alterungsprozess hemmen.
Gibberelline
Gibberelline sind Diterpene, die auf ein gemeinsames tetrazyklisches Grundskelett zurückgehen. Es wurden bisher weit über 100 verschiedene Strukturen beschrieben, von denen jedoch nur wenige physiologisch aktiv sind. Sie fördern das Internodienwachstum bei Pflanzen. Da Gene für die zahlreichen Enzyme der Giberellin-Biosynthese bereits kloniert werden konnten, kann ihre Expression in der Pflanze genauer untersucht werden. Deshalb kennt man die Orte der Biosynthese schon genauer. Offensichtlich läuft sie vor allem in rasch wachsenden Geweben und während früher Stadien der Samenentwicklung ab. In diesen Fällen lassen sich Bildungsorte und Wirkungsorte der Gibberelline kaum unterscheiden.
![]()
Wirkungsweise:
| |
| |
| |
|
Abscisinsäure
Im Gegensatz zu den vorher besprochenen Phytohormongruppen hat die Abscisinsäure eine vorwiegend hemmende Wirkung. Sie findet sich in allen Organen der Pflanze. Größere Mengen kommen im Herbst in den Ruheknospen vor, ebenso in Samen und Früchten. Unter Stresssituationen – insbesondere bei Wassermangel – bilden die unversorgten Gewebe innerhalb weniger Stunden große Mengen an Abscisinsäure. Auslöser ist in der Regel der abfallende Turgor. Dies gilt auch für die Wurzeln. Das Abscisin wird aus der Wurzel über das Xylem in den Spross transportiert und gelangt mit dem Transpirationsstrom an die Stomata. Dort induziert es den Verschluss der Spalten. Auch im Blatt wird bei Wassermangel Abscisinsäure produziert. Sie gelangt mit dem Phloem in die Wurzeln. Dort ist die Abscisinsäure an einer Erhöhung der hydraulischen Wasserleitfähigkeit beteiligt.
Wirkungen:
| |
|
Ethylen
Chemisch ist das Ethylen das einfachste Phytohormon Alle Pflanzen produzieren ständig geringe Mengen dieser Substanz und geben sie an die Umgebung ab. Deshalb kann es nicht nur als Hormon innerhalb eines Individuums, sondern auch als Botenstoff zwischen Individuen einer Art (Pheromon) und sogar zwischen Individuen verschiedener Arten (Kairomon) wirken. Synthetisiert wird Ethylen bei Bakterien, Pilzen und Pflanzen aus der Aminosäure Methionin.
Wirkungen:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Brassinosteroide (Brassinolide)
Diese wachstumsstimulierenden und stressmindernden Pflanzeninhaltsstoffe wurden zuerst aus Pollen von Brassica-Arten (Kohl) isoliert, wurden aber später bei vielen verschiedenen Pflanzen und auch bei Algen gefunden. Sie wirken vermutlich auf die Zellmembranen, doch ist der genaue Mechanismus bisher nicht bekannt.
Oxylipine
Auch Pflanzen verfügen wie Tiere über Signalstoffe, die sich chemisch von oxidierten Fettsäuren ableiten (bei Tieren z. B. die Prostaglandine, bei Pflanzen die Oktadekanoide). Besonders bedeutsam sind die Jasmonsäure und ihre Derivate, die Jasmonate. Jasmonsäure wird oft nach Verwundungen (Tierfraß) oder nach Befall mit Parasiten vermehrt gebildet. Sie fördert die pflanzlichen Abwehrreaktionen und kann auch als Pheromon bzw. Kairomon bei anderen Pflanzen ähnliche Reaktionen hervorrufen.
Peptide
Erst seit Kurzem weiß man, dass auch einige Polypeptide Hormonfunktionen bei Pflanzen haben. Das aus 18 Aminosäuren bestehende Systemin wurde aus Nachtschattengewächsen isoliert. Das Phytohormon wird über das Phloem transportiert und löst Abwehrreaktionen gegen Krankheitserreger aus.
Die nur aus 4-5 Aminosäuren aufgebauten Phytosulfokine sind für Dedifferenzierungsreaktionen verantwortlich: Sie können bewirken, dass bereits differenzierte Pflanzenzellen wieder totipotent werden.
Für alle Phytohormone ist charakteristisch, dass sie über teilweise komplizierte Signalwege auf die differenzierte Genexpression wirken.
-
Brassinosteroide
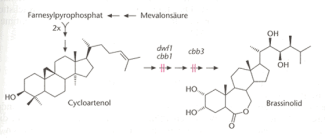
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Ethylen
- Signalübertragung
- Oxylipine
- Zellteilung
- Pflanzenhormone
- Streckungswachstum
- Auxine
- Pheromone
- Cytokinine
- Abscisinsäure
- Brassinosteroide
- Pflanzenwachstum
- Differenzierung
- Systemin
- Brassica-Arten
- Jasmonsäure
- Gibberelline
- Signalstoffe
- Auxin
- Meristem
- Regulation
- Indolessigsäure
- Phytohormone
- Sprossspitze
- Kairomone

