Speicherung von chemischer Energie
Autotrophe Organismen stellen aus energiearmen, anorganischen und körperfremden Stoffen energiereiche, organische und körpereigene Stoffe unter Ausnutzung einer äußeren Energiequelle her. Ausgangsgangsstoff für die Bildung der organischen Stoffe sind die gebildeten Glycerinaldehyd-3-phosphatmoleküle bzw. die Glucosemoleküle aus dem CALVIN-Zyklus. Unter anderem mit Hilfe von Mineralstoffen werden dann Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und andere organische Stoffe hergestellt.
Heterotrophe Organismen nehmen diese organischen Stoffe mit der Nahrung auf und bauen sie im Körper entsprechend ihres Bedarfs unter Ausnutzung derer Energie um. Andere entstehende Produkte, wie z. B. Vitamine oder Ballaststoffe nehmen als Wirk- und Ergänzungsstoffe in der täglichen Nahrung einen wichtigen Platz ein.
Aus dem Glycerinaldehyd-3-phosphat des CALVIN-Zyklus werden über Zwischenprodukte weitere Kohlenhydrate wie Glucose, Saccharose, Cellulose und Stärke gebildet.
Bakterien, die zur Fotosynthese befähigt sind, stellen statt Stärke Glykogen her. Fette bestehen aus Glycerin und Fettsäuren. Die Herstellung von Fettsäuren kann im Cytoplasma, in den Chloroplasten und teilweise im Mitochondrium erfolgen, die anschließend in den Chloroplasten mit Glycerin zu Fetten reagieren. Die Einzelbausteine der Eiweiße (Proteine) sind Aminosäuren.
Pflanzen verwenden Nitrate aus der Luft, über die Knöllchenbakterien fixierten Stickstoff oder direkt aufgenommene Ammonium-Ionen zur Bildung von Aminosäuren. Die entstandenen Aminosäuren können später ineinander umgewandelt werden. Die gebildeten Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße bzw. ihre Bausteine stellen dann die Grundlage für die Synthese anderer organischer Stoffe dar.
Energie brauchen alle Lebewesen für die Ausführung ihrer Lebensfunktionen. Aufgenommen wird die Energie über bestimmte Stoffe, die dann durch Umwandlung im Organismus die benötigte Energie freisetzen bzw. herstellen. Für Zeiten, in denen keine Ernährungsprodukte zur Verfügung stehen, ist es für den Organismus überlebenswichtig, eine Energiereserve zu besitzen, von welcher er nun zehren kann. Wo aber befindet sich dieser Energiespeicher in den Organismen?
Energiespeicherung bei Pflanzen
Bei autotrophen Organismen sind die gebildeten Glycerinaldehyd-3-phosphatmoleküle bzw. die Glucosemoleküle aus dem CALVIN-Zyklus Ausgangsstoff für die Bildung weiterer organischer Stoffe. Unter anderem mit Hilfe von Mineralstoffen werden dann Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und andere organische Stoffe (z. B. Alkaloide, organische Säuren, Nucleinsäuren u.a.) hergestellt, welche den tierischen Organismen später als Energielieferanten dienen. Pflanzen stellen ihre energiereichen Substrate also selber her und verwenden sie dementsprechend auch gleich als Energiereserve.
Da die Laubblätter selber einen ungünstigen Speicherort darstellen (Fressfeinde), transportieren die Pflanzen den überwiegenden Teil der Fotosyntheseprodukte (Glucose) aus den Laubblättern hinaus zu Zellen, die nicht zur Fotosynthese befähigt sind. Damit die pflanzlichen Energiespeicher nicht sofort durch heterotrophe Organismen wieder verbraucht werden, liegen die Speicherorte meist in den Wurzeln unter der Erde oder in verdickten bzw. verholzten Sprossachsen. Die Glucose wird dort in Form von Stärke gespeichert.
Fette eignen sich bei Pflanzen weniger zum Energie speichern. Zum einen müssten sie die Pflanzen extra produzieren, zum anderen sind sie in ihrer Struktur nicht fest genug (Stärke sorgt gleichzeitig für Stabilität). Da Fett pro Gramm mehr Energiegehalt aufweist als Kohlenhydrate eignet es sich vor allem zum Speichern von Energie auf kleinem Raum. Deshalb sind viele Pflanzensamen eher fetthaltig, denn dort kann auf kleinstem Raum genügend Energie für das Austreiben der jungen Pflanze bereit gestellt werden.
Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße stellen als Nährstoffe die wichtigsten Energieträger für die Lebewesen dar. Andere entstehende Produkte, wie z. B. Vitamine, Ballaststoffe nehmen als Wirk- und Ergänzungsstoffe in der täglichen Nahrung einen wichtigen Platz ein.
Wie erfolgt innerhalb der autotrophen Organismen die Bildung von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen?
Bildung weiterer Kohlenhydrate
Die weiteren Reaktionsschritte der aus dem CALVIN-Zyklus entlassenen Glycerinaldehyd-3-phosphat-Moleküle führen über die Bildung von Fructose-6-phosphat zu weiteren Kohlenhydraten wie Glucose, Saccharose, Cellulose und Stärke. Glucose wird vor allem in Früchten und Samen gespeichert und dient als Ausgangsstoff für die Bildung anderer Kohlenhydrate. Glucose muss dabei für die Herstellung von Saccharose, Cellulose und Stärke erst besonders aktiviert werden (Bildung von ADP-Glucose). In Form der Saccharose erfolgt der Transport der Kohlenhydrate zum Ort des Verbrauchs oder der Speicherung. Cellulose findet als Baustoff der Zellwände Verwendung.
Bei hoher Fotosyntheseleistung können zunächst 30 % der Fotosyntheseprodukte in Form von Assimilationsstärke in den Chloroplasten gespeichert werden. In der Dunkelheit erfolgt dann der vollständige Umbau der Assimilationsstärke zur Transportform Saccharose. Stärke wird als Energiereservestoff in Chloroplasten genauso wie in Amyloplasten gebildet und gespeichert. Die zur Fotosynthese befähigten Bakterien stellen im Cytoplasma Glykogen statt Stärke her. Glykogen wird sonst durch heterotrophe Organismen (Pilze, Bakterien und Tiere) synthetisiert und im Cytoplasma in Flockenform abgelagert.
-
Bildung weiterer Kohlenhydrate
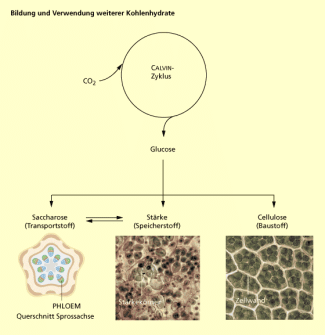
Bildung von Fetten
Fette bestehen aus Glycerin und Fettsäuren, die innerhalb der Pflanze gebildet werden müssen.
Die Herstellung von Fettsäuren kann im Cytoplasma, Chloroplast und z. T. im Mitochondrium erfolgen. Ausgangsstoffe für die Bildung der Fettsäuren sind Glycerinsäure-3-phosphatmoleküle als Primärprodukt des CALVIN-Zyklus oder die Zitronensäure der Zellatmung unter Beteiligung von aktivierter Essigsäure (Acetyl-CoA) als Startmolekül. Die gebildeten Fettsäuren reagieren später in den Chloroplasten mit Glycerin zu Ausgangsstoffen für die Bildung weiterer Neutralfette oder anderer Lipide, z. B. Strukturlipide, Carotinoide, Lignin oder Kautschuk (Bildung im Milchsaft).
-
Bildung von Fetten
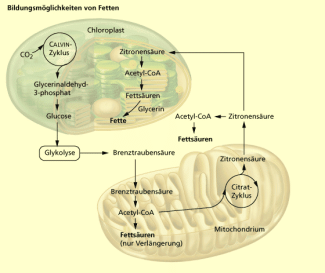
Bildung von Eiweißen
Die Einzelbausteine der Eiweiße (Proteine) sind Aminosäuren. Pflanzen verwenden Nitrate aus der Luft, über die Knöllchenbakterien fixierten Stickstoff oder direkt aufgenommene Ammonium-Ionen zur Bildung von Aminosäuren. Nitrate müssen über Nitrit zu Ammonium-Ionen unter Beteiligung von Elektronen des Fotosystems I reduziert werden, da nur Ammonium-Ionen das Element Stickstoff für weitere Stoffwechselreaktionen bereitstellen kann. Bei höheren Pflanzen findet die Herstellung von Aminosäuren in den Plastiden unter Beteiligung von Redox-Ketten und der Bereitstellung von Energie in Form von ATP statt (bei niederen Pflanzen teilweise im Cytoplasma). Schmetterlingsblütengewächse, die mit Knöllchenbakterien in Symbiose leben, produzieren aus dem Luftstickstoff über Ammonium-Ionen grundlegende Aminosäuren, welche dann im Xylem mit dem Transpirationsstrom zu anderen Orten weitertransportiert werden. Ein Knöllchen kann dabei pro Tag 3- bis 10-mal seinen eigenen gebundenen Stickstoff umsetzen.
Die einzelnen gebildeten Aminosäuren können ineinander umgewandelt und zu Eiweißen verknüpft werden.
Die gebildeten Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße bzw. ihre Bausteine stellen dann die Grundlage für die Synthese anderer organischer Stoffe dar.
Immer mehr prägen Überlegungen zur Nutzung dieser pflanzlichen Energie für den Menschen die Arbeit von wissenschaftlichen Forschungsinstituten und Umweltvereinen.
Energiespeicherung bei Tieren
Alle tierischen Organismen von den Bakterien bis zum Menschen vermögen Glucose über denselben Stoffwechselweg, die Glykolyse, abzubauen und dabei ATP aus ADP zu regenerieren. Das regenerierte ATP wird als Energielieferant für viele Stoffwechselreaktionen gebraucht, jedoch kann es in dieser Form nicht vom Organismus gespeichert werden. Die Folge einer großen ATP-Anreicherung in den Zellen wäre ein erhöhter osmotischer Druck, der schließlich zum Zerplatzen der Zellen führen würde. Deshalb können nur Stoffe gespeichert werden, die Wasser unlöslich sind. Dazu zählen die Makromoleküle. Es gibt 4 Gruppen von Makromolekülen: Nucleinsäuren, Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Die Nucleinsäuren und Proteine sind nicht zur Energiespeicherung geeignet. Kohlenhydrate und Fette eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften zur Speicherung der chemischen Energie.
-
Bildung von Aminosäuren
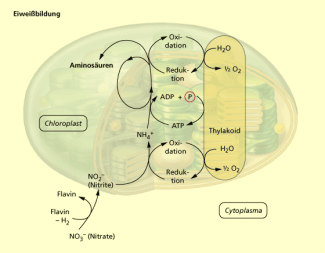
Heterotrophe (tierische) Organismen sind nicht in der Lage, Glucose selber herzustellen und nehmen die organischen Stoffe deshalb mit der Nahrung auf bevor sie sie im Körper entsprechend ihres Bedarfs umbauen. Sie sind jedoch in der Lage, Fett zu synthetisieren. Für eine längerfristige Speicherung wäre es eigentlich effektiver, ausschließlich Fett zu speichern, jedoch kann Fett nicht ohne Weiteres zu ATP abgebaut und den Muskelzellen zur Verfügung gestellt werden. Dafür wird eine Kohlenhydratreserve benötigt, die dann v.a. bei kurzfristigem Energiebedarf (hauptsächlich von den Muskeln) von Nutzen ist. Auch in der Leber kommt ein solcher Speicher vor, allerdings wird er hier nicht als Energie- sondern als Stoffspeicher benötigt, da die Leber beim Fasten (zwischen den Mahlzeiten) laufend Glucose abgibt, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Dieser „Verlust“ wird dadurch ausgeglichen.
Weitere Gründe, warum die Speicherung von Fett zum Hauptenergiespeicher im Tierreich geworden ist, sind die Isolation gegen Kälte aufgrund der schlechten Wärmeleitung von Fett sowie der Schutz gegen mechanische Einwirkungen von außen (Polsterung).

