Ziele der Verhaltensbiologie
Unerwartete Beobachtungen verlangen nach einer Erklärung. Gezielte Fragestellungen in Form von prüfbaren Hypothesen müssen formuliert werden, um zu konkreten Antworten zu gelangen. Jede Verhaltensweise hat proximate und ultimate Ursachen.
Die Verhaltensbiologie als Wissenschaft hat sich, gemessen an anderen biologischen Teildisziplinen, erst relativ spät entwickelt. In der Steinzeit z. B. war das Wissen über die Verhaltensweisen der Tiere für das Überleben des Menschen von existenzieller Bedeutung. Das Kennen der Gewohnheiten, Bevorzugungen und Aversionen der Tiere, die sich im Umfeld des Menschen aufhielten, war notwendig, um als Jäger erfolgreich Beute zu machen, und es verminderte gleichzeitig das Risiko, selbst zur Beute zu werden. Durch die Beobachtung tierischen Verhaltens steigerten unsere Vorfahren also ihren Fortpflanzungserfolg (Darwin-Fitness).
Beim Verhalten handelt es sich um beobachtbare, von Muskeln erzeugte Bewegungen. Verhalten ist, was ein lebendes Tier tut und wie es dies tut. Dazu zählen u. a.
- Bewegungen,
- Lautäußerungen,
- Körperhaltungen,
- ein aktives Abgeben von Duftstoffen oder aber
- eine Veränderung der Form und Farbe des Körpers.
Der Gesang eines Goldammermännchens ist für das geschulte menschliche Ohr ein im Frühjahr immer wieder zu erkennendes musikalisches „Tschitschi tschitschi tschitschi bäh“, bei dem die letzte Note nach unten gezogen wird. Der Vogelkundler (Ornithologe) jedoch wird dem Laien erklären, dass der Gesang für die Ohren des Vogels ganz und gar keine „Musik“ darstellt, sondern dass die Vögel eher aus funktionalen Gründen singen, um etwa ihren Artgenossen mitzuteilen, wo ihr Aufenthaltsort ist, um Geschlechtspartner anzulocken oder um ein Revier zur Aufzucht und Ernährung ihrer Jungen abzugrenzen und zu verteidigen. Vögel singen also, um zu überleben und um ihre Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Der Gesang der Vögel lässt sich sehr gut mithilfe moderner Methoden der Verhaltenserfassung untersuchen, ein gelungener Einstieg also in das Thema Verhalten. Auf diese Weise finden die Verhaltensforscher immer mehr über die Entwicklung, die Funktionen und die Konsequenzen des Vogelgesangs heraus. Außerdem ist der Vogelgesang ein geeignetes Modellsystem für tierisches Verhalten, weil mit ihm ein wichtiges Prinzip verdeutlicht werden kann:
Verhalten wird sowohl von genetischen Faktoren als auch von Umweltfaktoren beeinflusst.
NIKOLAAS TINBERGEN (1907–1989) hat ursprünglich vier Fragen der Verhaltensforschung bezüglich des Auftretens von Verhaltensphänomenen formuliert:
| 1. | Frage nach Mechanismus und Form des Auftretens |
| 2. | Frage nach den Ursachen in der Entwicklung (Ontogenese) |
| 3. | Frage nach der biologischen Funktion |
| 4. | Frage nach der Stammesgeschichte |
Schon bei der Formulierung der Frage denke ich mir also mögliche Antworten (Hypothesen) aus. Diese Hypothesen beziehen sich auf Zusammenhänge zwischen dem beobachteten Verhalten und den Bedingungen sowie zwischen einem Verhaltensphänomen und seinen Folgen.
In der Verhaltensbiologie zielen die Fragen auf zwei ganz verschiedene Aspekte ab: Entweder geht es um die Mechanismen, die der zu erklärenden Verhaltensweise zugrunde liegen, oder aber es geht um die Funktion, die die Verhaltensweise erfüllt. Das Verhalten der Individuen kommt einerseits durch die inneren und äußeren Faktoren (proximate Ebene) zustande und beeinflusst andererseits aufgrund seiner Funktionen die reproduktive Fitness (ultimate Ebene).
Um Verhalten umfassend zu analysieren, müssen sowohl auf der proximaten als auch auf der ultimaten Ebene Forschungen durchgeführt werden.
-
Hypothesenbildung
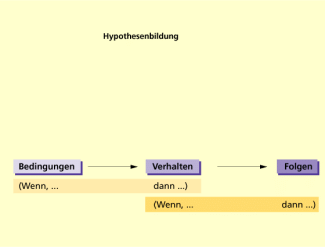
Frage: Warum singen Vögel im Frühjahr?
1. Proximate Ursachen von Verhalten
Wirkursache (direkt, unmittelbar)
| Die Frage wird formuliert: | |
| |
| |
| Wie wird das Verhalten ausgelöst und gesteuert? Inwieweit sind z. B. Gene oder Hormone an der Verhaltenssteuerung beteiligt? | |
Teildisziplinen der Verhaltensbiologie, die sich mit den proximaten Ursachen von Verhalten beschäftigen:
| |
|
Mechanismus der Verhaltenssteuerung:
Die Tageslänge nimmt im Frühjahr zu, dadurch steigt die Konzentration einzelner Hormone im Blut männlicher Singvögel. Dieser physiologische Prozess bewirkt das artspezifische Singen männlicher Vögel an speziellen Plätzen und zu bestimmten Zeiten.
Mechanismus der Verhaltensentwicklung:
Sowohl vorhandene Gene als auch Umweltfaktoren sind notwendig, damit Entwicklungsprozesse biologisch sinnvoll ablaufen können. So sind z. B. beim Buchfinkenmännchen die Grundstrukturen des Gesangs durch Gene vorgegeben, die Vielfältigkeit des arttypischen Gesangs jedoch wird erst erlernt.
2. Ultimate Ursachen von Verhalten
Zweckursache (indirekt, mittelbar)
| Die Frage wird formuliert: | |
| |
| |
| |
| Wozu dient die Verhaltensweise? Was ist ihr Anpassungswert? Welchen reproduktiven Nutzen hat das Individuum von seinem Verhalten? | |
Teildisziplinen, der Verhaltensbiologie, die sich mit den ultimaten Ursachen von Verhalten beschäftigen:
| |
|
Funktion des Verhaltens:
Vögel singen nicht in erster Linie, um ihren Artgenossen oder anderen Individuen eine Freude zu machen. Mit ihrem Gesang teilen sie ihren Artgenossen mit, wo ihr Aufenthaltsort ist. Sie locken damit fortpflanzungswillige Weibchen an bzw. grenzen ihr Revier gegenüber männlichen Rivalen ab.
Evolutionäre Bedeutung des Verhaltens:
Gene, die die Entwicklung von Verhaltensmustern oder aber des Körperbaus steuern, werden von den Vorfahren an die nachfolgenden Generationen vererbt. Die Vorfahren haben also das Verhaltensmuster des Gesangs der heute lebenden Singvögel vererbt. Das Vogelmännchen erhöht mit seinem Verhalten seinen Reproduktionserfolg.
-
Um Verhalten umfassend zu analysieren, müssen sowohl auf der proximaten als auch auf der ultimaten Ebene Forschungen durchgeführt werden.
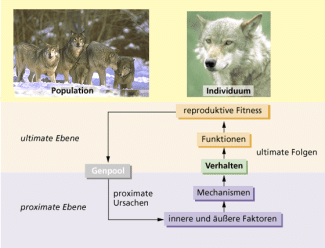
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Hypothesen
- Wissenschaft
- DARWIN-Fitness
- Reproduktionserfolg
- ultimate Ursachen
- Verhaltenssteuerung
- Verhaltensbiologie
- Verhaltensentwicklung (Ontogenese)
- Fortpflanzungserfolg
- Modellsystem für tierisches Verhalten
- NIKOLAAS TINBERGEN
- Umweltfaktoren
- Proximate Ursachen
- Methoden der Verhaltenserfassung
- genetische Faktoren

