Abiotische Umweltfaktoren
Umweltfaktoren sind die Faktoren, die aus der nicht lebenden und lebenden Umwelt direkt oder indirekt auf ein Lebewesen einwirken.
Es werden abiotische und biotische Umweltfaktoren unterschieden.
Abiotische Umweltfaktoren sind Faktoren der nicht lebenden Umwelt, die auf ein Lebewesen einwirken, z.B. Klima- und Bodenfaktoren. Sie beeinflussen den Stoff- und Energiewechsel, die Entwicklungsvorgänge sowie die Verhaltensreaktionen von Organismen.
Umweltfaktoren wirken auf Lebewesen
Die verschiedenen Arten können nur dort leben, wo die Umwelt für sie erträgliche Lebensbedingungen bietet. Diese Bedingungen in einem Ökosystem umfassen verschiedene Faktoren, Umweltfaktoren genannt. Sie stehen in vielfältiger Beziehung miteinander. Bei den auf Lebewesen einwirkenden Umweltfaktoren wird zwischen abiotischen Umweltfaktoren und biotischen Umweltfaktoren unterschieden.
Biotische Umweltfaktoren sind Faktoren der belebten Umwelt, die auf ein Lebewesen einwirken. Sie können von Lebewesen der gleichen Art oder von Lebewesen anderer Arten ausgehen.
Abiotische Umweltfaktoren sind Faktoren aus der nicht lebenden Natur. Sie können physikalischer oder chemischer Natur sein.
Einfluss abiotischer Umweltfaktoren
Auf dem Lande zählen zu den wichtigsten abiotischen Faktoren das Licht, das Wasser, die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit sowie die Beschaffenheit des Bodens (z.B. Körnung, pH-Wert, verfügbare Mineralstoffe). In Gewässern sind vor allem die Temperatur und der Sauerstoffgehalt sowie der Salzgehalt des Wassers und die Strömungsgeschwindigkeit von großer Bedeutung.
Abiotischer Umweltfaktor Licht
Für Pflanzen ist insbesondere der Umweltfaktor Licht unerlässlich, da nur dann die Fotosynthese erfolgen kann. Pflanzen werden ohne Licht rasch geschädigt; sie „vergeilen“ beispielsweise oder sterben ab, wenn nicht genügend Licht zur Verfügung steht.
Licht löst auch Bewegungen bei den meisten ortsfesten Pflanzen aus. Der Lichtfaktor hat auch auf die Abfolge des Blühens von Pflanzen, z.B. der Krautschicht eines Buchenwaldes, einen Einfluss.
Gut erkennbar ist weiterhin der Einfluss von Licht auf die Wuchshöhe von Pflanzen.
-
Auswirkung unterschiedlicher Lichtintensität auf Wachstum und Entwicklung von Wald-Ziest
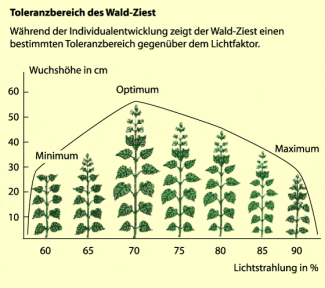
Licht beeinflusst auch Mensch und Tier
Bei Tieren spielt das Licht zwar eine geringere Rolle, es aktiviert aber den Lebensrhythmus der meisten Tiere und auch des Menschen. Der Wechsel von Licht und Dunkelheit, von Tag und Nacht bewirkt z.B. bei im Wald lebenden Tieren gut beobachtbare Aktivitäten im Verhalten. In der Dämmerung ist das Schwärmen von Mücken auffällig. Fledermäuse fliegen zwischen den Baumgipfeln.
In der Nacht jagen Eulen, Igel und Dachs ihre Beute. Waldmäuse suchen in den Nachtstunden ihre Nahrung. Regenwürmer kriechen auf der Erdoberfläche. Tagsüber sind die Sing- und Greifvögel aktiv. Eidechsen huschen zwischen Gesteinen, und in der Luft schwirren Käfer, Libellen und Fliegen. Entsprechend ihren Aktivitäten lassen sich tagaktive, nachtaktive und dämmerungsaktive Tiere unterscheiden.
Vom Licht beeinflusst wird auch der morgendliche Sangesbeginn der Vögel. Jede Art hat eine bestimmte Helligkeitsstufe, bei der sie munter wird und zu singen beginnt. Der „Frühaufsteher“ bei den Singvögeln ist die Amsel, danach folgen Meisen und Laubsänger. „Langschläfer“ sind Haussperling, Buch- und Grünfinken. Diese sogenannte „Vogeluhr“ lässt gewisse Regelmäßigkeiten erkennen. Sie ist aber nicht ganz zuverlässig, weil sich, bedingt durch die Jahreszeiten, der Zeitpunkt des Sonnenaufganges verschiebt. Außerdem wird der morgendliche Sangesbeginn durch Bewölkung, Nebel und wechselnde Temperaturen beeinflusst. Die „Frühaufsteher“ sind oftmals abends auch die letzten Sänger, z.B. Amsel, Rotkehlchen.
Abiotischer Faktor Temperatur
Wichtige Lebensprozesse der Pflanzen, wie Fotosynthese, Atmung, Transpiration, Keimung, Wachstum sowie Entwicklung und von Tieren, wie Aktivität, Verhalten, Wachstum und Entwicklung, sind abhängig vom abiotischen Faktor Temperatur. Der Einfluss der Temperatur lässt sich beispielsweise bei der Keimung von Samen leicht nachweisen. Viele Samen von Samenpflanzen keimen nur in einem bestimmten Temperaturbereich.
Keimtemperaturen einiger Samen von Kulturpflanzen
- Roggen: + 1 - 2 °C
- Erbse: + 1 - 5 °C
- Salat: + 1 - 5 °C
- Weizen: + 3 - 4 °C
- Mais: + 8 - 10 °C
- Bohne: + 10 °C
- Kürbis: + 10 - 12 °C
- Gurke, Tomate: + 12 - 16 °C
Die Entwicklung und der Zeitpunkt des Schlüpfens sowie die Anzahl geschlüpfter Raupen bei Schmetterlingen ist ebenfalls stark von der Temperatur abhängig.
Viele einheimische Säuger passen sich der kalten Jahreszeit durch das Abhalten einer Winterruhe bzw. eines Winterschlafs an. Die Winterruhe stellt einen Schlaf von besonderer Länge und Tiefe dar. Die Körpertemperatur dieser gleichwarmen Tiere (z.B. Eichhörnchen, Dachs) bleibt dabei konstant.
Der Winterschlaf dagegen ist durch eine deutliche Änderung im Stoff- und Energiewechsel des Körpers und einer damit verbundenen Aktivitätseinschränkung gekennzeichnet. Während die Körpertemperatur dieser gleichwarmen Tiere (z.B. Hamster, Haselmaus, Igel, Siebenschläfer, Fledermaus) im Aktivzustand je nach Tierart zwischen 36 und 40 °C liegt, wird sie im Winterschlaf auf Werte um 5 °C abgesenkt. Gleichzeitig sind Herzschlag und Atmung enorm gedrosselt. Der Winterschlafzustand wird dann durch das Eintreten einer kritischen Umgebungstemperatur ausgelöst.
In stehenden Gewässern (z.B. einem See) gibt es außerdem einen engen Zusammenhang zwischen der Temperatur des Wassers und dessen Sauerstoffgehalt. Je kälter das Wasser ist, desto höher ist der Sauerstoffgehalt. Das ist für die im Gewässer lebenden Organismen, insbesondere den Fischen, von großer Bedeutung.
Der abiotische Faktor Temperatur beeinflusst also Vorkommen und Lebensprozesse von Pflanzen sowie die Aktivität, das Verhalten und die Lebensprozesse von Tieren.
-
Sangesbeginn der Vögel in Abhängigkeit von der Helligkeit
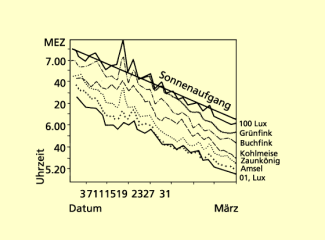
Abiotischer Faktor Bodenreaktion
Der pH-Wert (auch Bodenreaktion genannt) ist ein weiterer wesentlicher abiotischer Umweltfaktor. Er ist ein Wert für eine neutrale, saure oder basische Reaktion einer wässrigen Lösung, sei es eine Bodenlösung oder ein Gewässer.
Die Bestimmung der pH-Wertes kann
- mit dem Czensny-Colorimeter,
- einem pH-Messgerät oder
- mit Spezialindikatorstäbchen
erfolgen.
Der pH-Wert hat großen Einfluss auf das Wachstum und die Entwicklung der Lebewesen. So können z.B. viele Pflanzen nur auf Böden mit einem bestimmten pH-Wert gedeihen, das sind sogenannte Zeigerpflanzen. Viele Tiere entwickeln sich nur normal, wenn der entsprechende pH-Wert gegeben ist.
Die pH-Grenzwerte für einige Fischarten und andere Arten von Wassertieren
Vorzugswerte
- Süßwasserfische: pH 7 (6 - 8)
- Meeresfische: pH 8,2 - 8,4
Tödliche Werte im alkalischen Bereich
- Forelle, Barsch, Karausche: pH 9,2
- Plötze: pH 10,4
- Hecht: pH 10,7
- Karpfen, Schleie: pH 10,8
- Amerikanische Flusskrebse: pH 10,2
-
pH-Wert-Skala
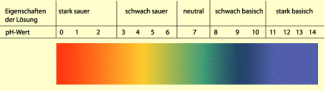
Der abiotische Umweltfaktor Wasser
Der abiotische Faktor Wasser ist für alle Organismen lebensnotwendig. Wasser ist wesentlicher Bestandteil ihrer Zellen sowie oftmals auch wichtiger Umweltfaktor in ihrem Lebensraum, sei es als Bestandteil der Luft (Luftfeuchtigkeit) oder des Bodens (Wassergehalt des Bodens).
Auf hohe Luftfeuchtigkeit sind z.B. Kräuter mit großen Laubblättern, die keine Schutzvorrichtungen vor Verdunstung aufweisen (u.a. keine Kutikula, keine toten Haare), angewiesen (z.B. Großes Hexenkraut). Tiere (z.B. Lurche) mit nackter feuchter Haut können nur in Biotopen leben, die eine hohe Luftfeuchtigkeit besitzen. So sind die Organismen durch bestimmte Merkmale an den Faktor Wasser angepasst.
| Anpassung von Pflanzen an den abiotischen Faktor Wasser | |||
| Pflanzen | Teillebensräume | Anpassungs- erscheinungen | Bezeichnung |
| Sumpf-Dotter- blume | an Gräben, in feuchten Senken | dünne Blätter, Spaltöffnungen an der Oberseite häufiger und emporgehoben | Feuchtpflanze |
| Rotbuche | auf mäßig feuchten bis mäßig trockenen Böden | Schattenbaum- art mit häufig weichen Blättern, bei Trockenheit Blattabwurf | wandlungs- fähige Pflanze |
| Heidekraut | auf sandigen, trockenen Böden | meist kleine lederartige Blätter mit versenkten Spaltöffnungen | Trockenpflanze |
Die Luftfeuchtigkeit wird mit einem Hygrometer ermittelt.
-

Valerianic - GettyImages
Chemische Stoffe als abiotische Faktoren
Als abiotische Faktoren haben auch zahlreiche chemische Stoffe wesentliche Bedeutung. Dazu zählen u.a. Stickstoffverbindungen (z.B. Ammoniak, Nitrate, Nitrit) und Phosphatverbindungen sowie Rückstände beispielsweise von Pflanzenschutzmitteln und Waschmitteln. Stickstoff- und Phosphatverbindungen sind einerseits wichtige Nährstoffe für Pflanzen mit Chlorophyll und werden deshalb über Düngemittel den Pflanzen zusätzlich gegeben.
Andererseits können sie auch Schaden anrichten, wenn sie im Überfluss (Überdüngung) vorhanden sind, ausgewaschen werden und in die Gewässer gelangen. Hier fördern sie das Wachstum und die Entwicklung von Algen („Algenblüte“), was schließlich zur Störung des Gleichgewichts in einem Gewässer führt.
Zu viel Nitrate und Nitrite im Trinkwasser führen zu Gesundheitsschäden, insbesondere bei Kleinkindern.
Im Wasser sind auch Schwefelwasserstoff, Chlor, Kupfer und manchmal auch Schwermetalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber und Zink gelöst. In höheren Konzentrationen sind alle Schwermetalle für Organismen giftig.
Abiotische Faktoren beeinflussen sich wechselseitig
Die einzelnen abiotischen Faktoren beeinflussen sich wechselseitig und wirken komplex auf Organismen. So ist z.B. eine hohe Lichtintensität mit der Erhöhung der Temperatur der Umgebung von Pflanzen verbunden, was die Verdunstung (Transpiration) erhöht. Dies führt schließlich zum Schließen der Spaltöffnungen und damit zur Einschränkung der Fotosynthese.
Wachstum und Entwicklung von Organismen sind generell von mehreren abiotischen Faktoren abhängig. Begrenzenden Einfluss hat der Faktor, der sich im Minimum befindet.
Durch die Folgen der menschlichen Tätigkeit kann es zu gravierenden Veränderungen abtiotischer Faktoren und damit des Biotops insgesamt kommen. Gelangen z.B. ungereinigte Abwässer (mit giftigen Schadstoffen belastete, z.B. Arsen, Blei) in die Umwelt, kann das gesamte Gefüge abiotischer Faktoren so verändert werden, dass Organismen nicht mehr existieren können.

