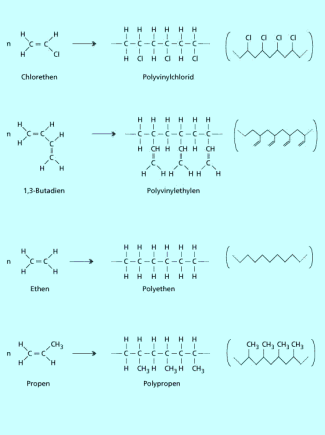Hermann Staudinger
* 23.03.1881 in Worms
† 08.09.1965 in Freiburg (Breisgau)
HERMANN STAUDINGER war ein deutscher Chemiker.
Er erforschte organische Verbindungen, z. B. die Ketene, organische Kolloide, Cellulose, Stärke, Glykogen und Kautschuk. Der Begriff „Makromolekül“ stammt von ihm. STAUDINGER wies nach, dass sich kleinere Moleküle, sogenannte Monomere, zu größeren Molekülen, sogenannten Polymeren, verbinden können. Damit schuf er die Grundlagen der Kunststoffchemie.
1953 erhielt der Wissenschaftler den Nobelpreis für Chemie.
1. Die Zeit, in der er lebte
HERMANN STAUDINGER lebte im zwanzigsten Jahrhundert, in einer sehr bewegten Zeit. Er stammt aus Worms und studierte in Deutschland.
Den ersten Weltkrieg verbrachte STAUDINGER in der Schweiz, wo er als Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich lehrte und forschte. Er kehrte in den zwanziger Jahren wieder nach Deutschland zurück und blieb auch während des zweiten Weltkrieges hier.
2. Lebenslauf
HERMANN STAUDINGER wurde am 23. März 1881 in Worms geboren. Sein Vater, Dr. FRANZ STAUDINGER, war Philosoph in Darmstadt. Er riet ihm, nach der Schule Chemie zu studieren und eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen.
STAUDINGER ging in Worms zu Schule und interessierte sich schon früh für Naturwissenschaften.
1899 beginnt er sein Studium zuerst an der Universität von Halle und studiert in Darmstadt, München und wieder in Halle, wo er 1903 graduiert.
Später, 1907, wird HERMANN STAUDINGER Assistenzprofessor für organische Chemie an der Technischen Hochschule in Karlsruhe.
Im Jahre 1910 befasst sich der Wissenschaftler für die BASF mit der Synthese von Isopren. Dabei entdeckt er, dass die bisher geltenden Theorien über die Struktur von natürlichem Kautschuk falsch sein müssen. Er entwickelt eine neue Hypothese, die von langen Molekülen ausgeht, hat jedoch Schwierigkeiten, diese experimentell nachzuweisen.
So sucht STAUDINGER nach einfacheren Strukturen, und beschäftigt sich mit dem Styren (Styrol, Bild 3).
Bis 1912 bleibt STAUDINGER als Professor in Karlsruhe.
1912 wechselt er nach Zürich und lehrt für 14 Jahre an der Eidgenössischen Technischen Hochschule.
Bis in die zwanziger Jahre hinein wurden in der chemischen Industrie bereits Kunststoffe hergestellt. Am erfolgreichsten waren dabei die sogenannten Bakelite, Hartplastikwerkstoffe (Bild 4). Die Wissenschaftler begannen damit, diese systematisch zu erforschen, um ihre Molekülstruktur zu entschlüsseln.
Von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten solcher künstlich hergestellter Werkstoffe fasziniert, beginnt STAUDINGER 1920 damit, ihre chemischen Eigenschaften zu erforschen.
1922 veröffentlicht der Wissenschaftler einen Artikel in der Schweizer Wissenschaftszeitung „Helvetica Chimica Acta“ über die Struktur großer Moleküle und prägt den Begriff „Makromoleküle“. Gleichzeitig erklärt er den Vorgang der Polymerisation.
-
Formel von Styren, Gleichung der Polymerisation zu Polystyren
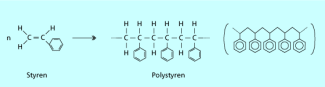
-
Formaldehydharze (Fön aus Bakelit) können Amino- oder Phenoplaste sein.
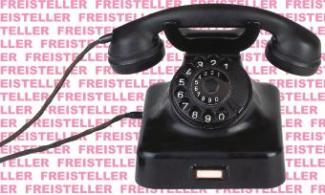
STAUDINGERs Studien besagten, dass Polymere (Bild 5) aus langen Molekülketten bestehen. Diese sind aus vielen gleichen oder ähnlichen chemischen Einheiten zusammengesetzt.
Der Wissenschaftler postuliert in seinen Abhandlungen, dass die außergewöhnliche Zugfestigkeit und Elastizität der hergestellten Polymere das Ergebnis dieser großen Länge ihrer Moleküle sind.
Für seine Erkenntnisse wird er von seinen Kollegen verspottet, und die Theorien haben kaum Auswirkungen auf die wissenschaftlichen Forschungen. Bis 1928 streiten führende Chemiker die Existenz polymerer Kettenmoleküle ab. Erst KURT MEYER und HERRMANN MARK, die für die I. G. Farben in Ludwigshafen arbeiten, beweisen die Existenz solcher Molekülketten durch die Aufklärung der Struktur mittels Röntgenstrahlen.
1926 wird HERMANN STAUDINGER zum Professor an der Universität Freiburg berufen.
1935 trifft STAUDINGER in Cambridge auf einer Konferenz seinen amerikanischen Kollegen WALLACE CAROTHERS, der sich ebenfalls mit Polymeren befasst. Die Wissenschaftler tauschen sich aus und ergänzen ihre Erkenntnisse.
Ab 1940 ist STAUDINGER der Leiter des Instituts für Makromolekulare Chemie in Freiburg.
Gegen Ende seiner wissenschaftlichen Karriere wendet sich STAUDINGER wieder den biologischen Makromolekülen zu.
1953 erhält HERMANN STAUDINGER den Nobelpreis für Chemie in Anerkennung seiner Erkenntnisse zu Polymeren.
Hermann Staudinger stirbt am 8. September 1965 in Freiburg (im Breisgau).
3. Bedeutende Leistungen
Werke (Auswahl):
| „Ketene“ (1912); | |
| „Die hochmolekularen organischen Verbindungen“ (1932); | |
| „Makromolekulare Chemie und Biologie“ (1947); | |
| „Organische Kolloidchemie“ (1950). |
-
Beispiele für die Ausbildung zellenförmiger Polymerstrukturen durch Polymerisation