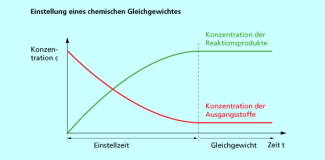Massenwirkungsgesetz
Bei reversiblen chemischen Reaktionssystemen stellt sich ein Gleichgewicht zwischen Hin- und Rückreaktion ein. Solche Reaktionen verlaufen nicht vollständig, d. h. die Konzentration der Ausgangsstoffe sinkt nicht auf null. In Abhängigkeit von den Reaktionsbedingungen (Druck, Temperatur) werden konstante Gleichgewichtskonzentrationen der an der Reaktion beteiligten Stoffe erreicht. Mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes können diese in Form der Gleichgewichtskonstanten berechnet werden.
Viele chemische Reaktionen laufen nie vollständig ab, sondern sie erreichen einen Gleichgewichtszustand. Dieser Zustand ist dadurch gekennzeichnet, dass in einer bestimmten Zeiteinheit ebenso viele Produktmoleküle zu den Ausgangsstoffen reagieren, wie Produktmoleküle aus den Ausgangsstoffen gebildet werden. Folglich ändert sich die Konzentrationen der an der Reaktion beteiligten Stoffe nicht mehr, d. h. die Konzentrationen bleiben konstant.
Es dauert jedoch eine gewisse, von Reaktion zu Reaktion unterschiedliche Zeit, bis sich diese Gleichgewichtskonzentrationen eingestellt haben. Die Zeitspanne bis zum Erreichen der konstanten Konzentrationen nennt man Einstellzeit des chemischen Gleichgewichts (Bild 2).
Chemische Reaktionen laufen in homogener Phase nie vollständig ab, sondern sie erreichen einen Gleichgewichtszustand. Dieser Zustand ist durch gekennzeichnet, daß pro Zeiteinheit ebenso viele Produktmoleküle zu den Ausgangsstoffen reagieren, wie Produktmoleküle gebildet werden. Das bedeutet, daß sich die Konzentrationen der an der Reaktion beteiligten Stoffe nicht mehr ändert, die Geschwindigkeit von Hin- und Rückreaktion sind gleich. Betrachtet man das Reaktionsgemisch als Ganzes so erfolgen keine Veränderungen mehr, während bei einer Betrachtung einzelner Moleküle Veränderungen zu beobachten sind. Einen solchen Zustand bezeichnet man als dynamisch. Das chemische Gleichgewicht ist ein dynamischer Zustand, der keine makroskopische Veränderungen aufweist.
Das chemische Gleichgewicht stellt sich bei umkehrbaren (reversiblen) Reaktionen ein und wird in der Reaktionsgleichung durch einen Gleichgewichtspfeil charakterisiert.
Die Einstellung des Gleichgewichtes erfolgt unabhängig davon, ob man von A und B oder von C und D ausgeht. Im Gleichgewicht liegen die vier Stoffe in den gleichen jeweiligen Konzentrationen vor, den Gleichgewichtskonzentrationen.
Mathematisch lässt sich das chemische Gleichgewicht durch das Massenwirkungsgesetz beschreiben, das 1867 vom norwegischen Technologen und Mathematiker CATO MAXIMILIAN GULDBERG (1836-1902) und dem norwegischen Chemiker PETER WAAGE (1833-1900) hergeleitet wurde.
Definition
Bei gegebener Temperatur ist der Quotient aus dem Produkt der Konzentrationen der Reaktionsprodukte und dem Produkt der Konzentrationen der Ausgangsstoffe eine Konstante die Gleichgewichtskonstante K.
Für die oben genannte allgemeine Beispielreaktion lautet des Massenwirkungsgesetz:
Für die Reaktion lautet des Massenwirkungsgesetz:
Die stöchiometrischen Faktoren (a,b,c,d) der einzelnen Stoffe (A;B;C;D) erscheinen im MWG als Exponenten der jeweiligen Konzentrationen.
Die Einheit für die Gleichgewichtskonstante ist:
Nur für den Fall das c+d = a+b ist, weist die Gleichgewichtskonstante keine Einheit auf.
Das Gleichgewicht der reversiblen Reaktion liegt auf der Seite der Reaktionsprodukte (C;D), wenn die Gleichgewichtskonstante K >1 ist.
Ist die Gleichgewichtskonstante K <1, liegt das Gleichgewicht auf Seiten der Ausgangsstoffe (A;B).
Das Massenwirkungsgesetz bezieht sich immer auf eine konkrete Reaktionsgleichung. Vereinbarungsgemäß stehen auf der linken Seite - vor dem Reaktionspfeil - die Ausgangsstoffe (Edukte) und auf der rechten Seite - nach dem Reaktionspfeil - der Reaktionsgleichung die Endstoffe (Produkte).
Wird die obige Gleichung in der Form
geschrieben, so erhält man den reziproken Wert der obigen Gleichgewichtskonstanten, also 1/K.
Beispiel
Ein Beispiel für eine reversible Reaktion, bei der sich ein chemisches Gleichgewicht einstellt, ist die Veresterung eines Alkohols mit einer Säure, z. B. die Reaktion zwischen Ethanol und Essigsäure.
![]()
Die chemischen Reaktionen zur Esterbildung und Esterspaltung laufen gleichzeitig ab. Es stellt sich ein chemisches Gleichgewicht ein.
Werden Ethanol und Essigsäure in einem geschlossenen Gefäß im Stoffmengenverhältnis 1 mol : 1 mol gemischt (mit Schwefelsäure als Katalysator versetzt) reagieren bei einer bestimmten Temperatur nur 0,67 mol der Ausgangsstoffe zu Ester und Wasser. 0,33 mol der Ausgangsstoffe bleiben unverändert.
Im Gleichgewicht liegen dann 0,67 mol Ester, 0,67 mol Wasser, 0,33 mol Alkohol und 0,33 mol Säure vor. Das gleiche Ergebnis wird erhalten, wenn man 1 mol Ester mit 1 mol Wasser umsetzt.
Setzt man die Gleichgewichtskonzentrationen in das MWG ein, so ergibt sich eine Gleichgewichtskonstante von K = 4. Die Gleichgewichtskonstante ist nur temperaturabhängig und bleibt bei einer Druckänderung gleich.
Die Abhängigkeit chemischer Gleichgewichte von den äußeren Bedingungen beschreibt das vom französichen Chemiker HENRY LOUIS LE CHATELIER (1850-1936) formulierte Prinzip vom kleinsten Zwang. Danach versucht ein chemisches System einem äußeren durch die Änderung von Druck oder Temperatur verursachten Zwang auszuweichen. Dadurch ändert sich das Verhältnis der Konzentrationen der Ausgangsstoffe und Reaktionsprodukte und somit die Gleichgewichtskonstante K.
Katalysatoren haben keinen Einfluß auf die Gleichgewichtslage und damit auch nicht auf den Wert der Gleichgewichtskonstante. Die Formel des Massenwirkungsgesetztes bleibt unverändert. Katalysatoren bewirken nur eine Veränderung der Reaktionsgeschwindigkeit der Hin- und Rückreaktion, d. h. sie verringern die Einstellzeit des chemischen Gleichgewichts.
Die Ausbeute der chemischen Reaktion ist nicht identisch mit der Gleichgewichtskonstanten, auch wenn die beiden Größen mathematisch zusammenhängen.
Ausbeute:
Verändert man die Konzentrationen der am Gleichgewicht beteiligten Stoffe, so läuft die Reaktion in der Richtung ab, die zur Wiederherstellung des Werts der Gleichgewichtskonstante führt.
Da dadurch die Geschwindigkeiten der Hin- und Rückreaktionen unterschiedlich sind, wird mehr von den Produkten oder Edukten gebildet, bis sich ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. Das Gleichgewicht verschiebt sich so, dass der Quotient des Massenwirkungsgesetzes gleich bleibt.
Das bedeutet, erhöht man die Konzentration eines Eduktes, so verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung der Produkte.
Wird z. B. bei der Esterbildung die Produkte, Ester und Wasser, aus dem Reaktionsgemisch entfernt, so verschiebt sich kurzzeitig das Gleichgewicht. Es liegen jetzt mehr Ausgangsstoffe Alkohol und Säure vor. Ester werden daraufhin weiter vermehrt gebildet und damit die Ausgangsstoffe Alkohol und Säure mehr verbraucht. Das geschieht solange, bis sich das Gleichgewicht zwischen Reaktionsprodukten und Ausgangsstoffen eingestellt hat. D.h. die Gleichgewichtskonstante ist unverändert. Es liegen wieder 67% Ester und Wasser und 33% der Ausgangsstoffe Alkohol und Säure vor.
Erhöht man z. B. die Konzentration eines Ausgangsstoffes im chemischen Gleichgewicht, so entsteht eine größere Menge Reaktionsprodukt. Der Wert der Gleichgewichtskonstante bleibt davon unberührt. Die Ausbeute an Reaktionsprodukt erhöht sich jedoch (Rechenbeispiel 2). Daraus folgt, dass die Ausbeute durch Änderung der Konzentration eines Ausgangsstoffes beeinflusst werden kann, die Gleichgewichtskonstante jedoch nicht.
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Veresterung
- Ausgangsstoffe
- Cato Maximilian Guldberg
- Gleichgewichtskonstante
- MWG
- Ausbeute der chemischen Reaktion
- Katalysatoren
- Massenwirkungsgesetz
- PETER WAAGE
- Reaktionsprodukte
- dynamischer Zustand
- Prinzip vom kleinsten Zwang
- Rechenbeispiel
- HENRY LOUIS LE CHATELIER
- stöchiometrischen Faktoren
- chemisches Gleichgewicht