Enzyme als Biokatalysatoren
Enzyme sind hochmolekulare Eiweißkörper, die als Biokatalysatoren bei sehr vielen Stoffwechselreaktionen in tierischen sowie pflanzlichen Organismen beteiligt sind. Die an der Reaktion beteiligten Substanzen (Substrate) werden dort angelagert, in der Reaktion umgesetzt und nach Ablauf der Reaktion als Produkt abgelöst. Ein Enzym kann aber nur eine der für das Substrat möglichen Reaktionen katalysieren (Wirkungsspezifität). Außerdem sind Enzyme substratspezifisch, d. h. an jedes Enzym passen nur die Substanzen, die eine bestimmte, zum Enzym passende Struktur besitzen (Schlüssel-Schloss-Prinzip). Es gibt aber auch Enzyme, die ähnlich gebaute Substanzen umsetzen. In diesem Fall spricht man von Gruppenspezifität.
Enzymatische Vorgänge waren schon in prähistorischer Zeit bekannt, jedoch ohne die bewusste Kenntnis von Enzymen und deren Wirkungsweise.
Enzyme (griech.: enzymon, in der Hefe bzw. dem Sauerteig enthalten) sind hochmolekulare Eiweiße, die als Biokatalysatoren bei sehr vielen Stoffwechselreaktionen in tierischen sowie pflanzlichen Organismen beteiligt sind. Früher wurden die Enzyme auch als Fermente bezeichnet. Enzyme beschleunigen chemische Reaktionen des Stoffwechsels. Dabei wird die Aktivierungsenergie durch intermediäre Bildung eines Enzym-Substrat-Komplexes verringert.
Die Funktion des Enzyms ist nicht an den lebenden Organismus gebunden, da sie auch außerhalb des Organismus wirken, sondern vielmehr an die Unversehrtheit seines räumlichen Aufbaus. Diese festgelegte räumliche Struktur wird durch die Anordnung mehrerer benachbarter Aminosäurereste bestimmt. Sie bilden das Aktivitätszentrum. Die an der Reaktion beteiligten Substanzen (Substrate) werden dort angelagert, in der Reaktion umgesetzt und nach Ablauf der Reaktion als Produkt abgelöst. Das Aktivitätszentrum kann auch durch ein Coenzym mit Nichtproteincharakter repräsentiert sein. Das Coenzym verbindet sich dann mit dem alleine nicht wirksamen Enzymprotein (Apoenzym) zum aktiven Enzym (Holoenzym).
Coenzyme können Derivate von Vitaminen sein. Es können aber auch einfach nur Metall-Ionen sein. Diese Enzyme bezeichnet man oft auch als Metallenzyme oder Metallproteide (z. B. die eisenhaltigen Enzyme der Atmungskette).
Enzyme sind Kolloide, d. h., sie diffundieren nicht durch Membranen. Aufgrund ihrer proteinartigen Struktur werden sie beim Erhitzen auf über 60 °C unter Zugabe von Säuren, Basen oder Schwermetall-Ionen irreversibel zerstört (denaturiert). Die chemische Veränderung wirkt sich dabei in erster Linie auf die räumliche Struktur des Enzyms aus.
-
Hefepilze
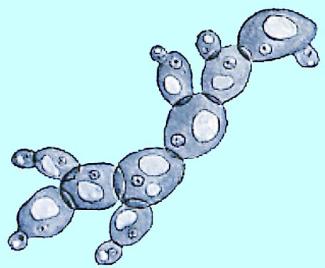
Die gemeinsam am Ablauf einer Stoffwechselreaktion beteiligten Enzyme sind meistens in bestimmten Zellräumen zusammengefasst, beispielsweise die Enzyme der Atmungskette in den Mitochondrien, der Eiweißsynthese in den Ribosomen. Dies hat den Vorteil, dass die darin befindlichen Substrate auch nur von den ebenfalls darin befindlichen Enzymen umgesetzt werden können. Konkurrierende Umsetzungen sind nicht möglich.
Eine Substanz kann im Organismus mehreren Reaktionen unterzogen werden (z. B. Oxidation, Reduktion). Ein Enzym kann aber nur eine der für das Substrat möglichen Reaktionen katalysieren (Wirkungsspezifität). Außerdem sind Enzyme substratspezifisch, d. h. an jedes Enzym passen nur die Substanzen, die eine bestimmte, zum Enzym passende Struktur besitzen (Schlüssel-Schloss-Prinzip).
Beispielsweise lösen die Verdauungsenzyme die Zerlegung der Grundnährstoffe (Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße) in ihre wasserlöslichen Bestandteile aus und steuern diesen Vorgang. Dabei verändern sie sich selbst nicht und können immer wieder diese Reaktionen bewirken. Es werden mit dem Ausgangsstoff Zwischenverbindungen gebildet, aus denen sie nach Ablauf der biochemischen Reaktion wieder unverändert hervorgehen. Der Ausgangsstoff muss zum Enzym passen.
Es gibt aber auch Enzyme, die ähnlich gebaute Substanzen umsetzen. In diesem Fall spricht man von Gruppenspezifität.
Enzyme werden nach dem Substrat bezeichnet, zu dem sie eine Affinität besitzen, indem man an den Stamm des Substratnamens die Endung -ase anhängt, z. B. heißt das die Maltose spaltende Enzyme Maltase.
Einteilung der Enzyme
Die Einteilung der Enzyme erfolgt in 6 Hauptklassen. Diese unterscheiden sich in ihrer Wirkungsspezifität.
- Oxidoreduktasen katalysieren Oxidationen und Reduktionen.
- Transferasen katalysieren die Übertragung von funktionellen Gruppen (z. B. Aldehyd-, Amino- und Glycosylgruppen).
- Hydrolasen sind hydrolytisch spaltende Enzyme (z. B. Ester-, Peptid- und Glycosidspaltungen).
- Lyasen katalysieren die Spaltung von C-C-; C-O-; C-N- und C-S-Bindungen (z. B. Dehydratasen, Decarboxylasen).
- Isomerasen katalysieren die Umwandlung in andere Isomere.
- Ligasen katalysieren den Aufbau neuer C-C-; C-O-; C-N- und C-S-Bindungen (z. B. Carboxylasen, Synthetasen).
Die Schnelligkeit der enzymatischen Umsetzung wird durch die Enzymaktivität veranschaulicht. Sie ist von vielen äußeren Faktoren, z.B. pH-Wert und Temperatur, abhängig und wird in Enzymeinheiten (kat; katal) angegeben. Dabei handelt es sich um eine internationale Einheit, welche die Enzymmenge angibt, die die Umwandlung von 1 mol Substrat in einer Zeiteinheit (z. B. 1 s oder 1 min) unter Standardbedingungen katalysiert.
Enzyme finden heute eine große Anwendung in der quantitativen und qualitativen Analytik. Die Enzymdiagnostik ist ein sich rasch entwickelndes Gebiet.
-
Wirkungsweise der Enzyme
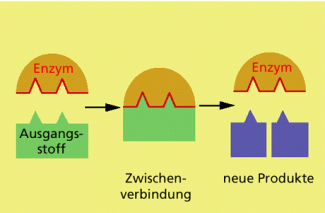
Historisches
Fermentative Vorgänge waren schon in prähistorischer Zeit bekannt. Schon lange bevor man schreiben konnte, wurde beispielsweise Hefe genutzt. Eine zufällige Entdeckung im alten Ägypten brach mit der bis dahin bekannten Reinheitstradition beim Brotbacken, welche besagte, dass zum Backen nur Mehl und Wasser verwendet werden durften. Aus diesen Zutaten entstanden dann die noch heute bekannten Fladenbrote. Die Ägypter bemerkten, dass übrig gebliebener und über Nacht sauer gewordener Brotteig beim Backen nicht nur bessere Backeigenschaften entwickelte, sondern auch einen anderen Geschmack. Die Ägypter verliebten sich in dieses neue Brot und wurden deshalb von ihren Nachbarn spöttisch als Brotfresser bezeichnet.
Das neue Brot entwickelte neben dem neuen Geschmack auch viel feinere und gleichmäßig verteilte Bläschen beim Backen. Dadurch wurde das Brot lockerer. Diese Eigenschaften werden durch die während der Ruhezeit von Bakterien gebildete Milch- und Essigsäure sowie das durch Hefe gebildete Kohlenstoffdioxid hervorgerufen. Noch heute ist diese Vorgehensweise bekannt. Man bezeichnet es als Sauerteig und das daraus hergestellte Brot als gesäuertes Brot. Die Umsetzungen wurden durch Enzyme (griech.: enzymon, in der Hefe bzw. dem Sauerteig enthalten) katalysiert. Enzyme bewirken auch u. a. das Nachreifen von gelagerten Früchten.
Die Natur der direkten Enzymwirkung wurde aber erst 1834 von BERZELIUS erkannt. 1836 isolierte THEODOR SCHWANN (1810-1882) das Pepsin aus dem Magensaft und 1894 EMIL FISCHER (1852-1919) Maltase und Lactase. Danach verlief die Entwicklung sehr schnell, denn 1911 erkannten A. MATHEWS und GLENN, dass Enzyme ein Coenzym und ein Apoenzym enthalten. 1926 gelang es SUMMER, das erste Enzym zu kristallisieren, die Urease. 1930 konnte NORTHROP das erstmals bei Pepsin und Trypsin tun.

