Polymere in der Elektroindustrie
In der Elektroindustrie werden Kunststoffe seit jeher als Isolationsmaterial und für die Gehäusekonstruktion eingesetzt. Neuere Entwicklungen führten zu elektrisch leitenden Polymeren, die für Akkumulatoren und elektronische Bauteile genutzt werden. In der Zukunft ist gar ein Ersatz der herkömmlichen teuren Silicium-Chips durch maßgeschneiderte Kunststoffe denkbar.
Kunststoffe in der Elektroindustrie
Naheliegend ist die Verwendung von Kunststoffen als Isolationsmaterial und für die Gehäusekonstruktion. Bereits die ersten Bakelite wurden für die Herstellung von Gehäusen für Steckdosen und Schalter in der industriellen Fertigung genutzt. Ausschlaggebend ist die hervorragende Isolationswirkung der reinen Phenoplaste, die aufgrund ihrer Struktur keine elektrische Leitfähigkeit aufweisen. Hinzu kommt die einfache formgebende Verarbeitung der preiswerten Duroplaste.
Ein anderes Beispiel ist die Ummantelung von Kabeln durch Polyester oder elastische Polyamide.
Elektrisch leitende Kunststoffe
Leitende Kunststoffe kennt man schon lange, jedoch handelte es sich dabei zunächst um „gewöhnliche“, isolierende Polymere, die erst durch Zusatz von elektrisch leitenden Partikeln wie Metallstäuben oder Ruß leitfähig wurden.
1976 entdeckte der Japaner HIDEKI SHIRAKAWA durch Zufall den ersten wirklich leitfähigen Kunststoff. Durch versehentliches Abweichen von der Synthesevorschrift erhielt er eine neue Form des Polyacetylens (PA), Statt des üblichen schwarzen Pulvers entstand eine silberglänzende, elastische Folie. Das „neue“ PA war zwar noch ein Isolator, jedoch entdeckten SHIRAKAWA und die Amerikaner ALAN HEEGER und ALAN MAC DIARMID bald, dass sich durch „Dotierung“ mit Iod seine Leitfähigkeit immens steigern lässt. Heute kennt man schon PA-Folien, deren Leitfähigkeit fast so gut ist wie die des Kupfers und das bei viel geringerer Masse.
Am Beispiel des PA lassen sich leicht die Voraussetzungen aufzeigen, die für leitende Kunststoffe erfüllt sein müssen:
Die Polymerketten weisen ein weitverzweigtes delokalisiertes Elektronensystem aus lauter konjugierten Doppelbindungen auf (Bild 2).
Damit die Kettenmoleküle den elektrischen Strom leiten, müssen sie dotiert werden. Chemisch bedeutet dies, dass durch Oxidation oder Reduktion der Polymerfolien entweder einige Elektronen auf den Ketten entfernt (p-Dotierung) oder hinzugefügt (n-Dotierung) werden. Auf diese Weise verbleiben einzelne freie Elektronen, die wie bei den Metallen nicht mehr an die Atomrümpfe gebunden sind, sondern an den Molekülen entlanggleiten und so elektrische Ladung transportieren können.
-
Strukturausschnitt Polyacetylen
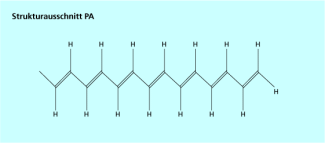
SHIRAKAWA und MAC DIARMID erreichten dies, indem sie oxidierenden Ioddampf auf Polyacetylen einwirken ließen.
Besonders einfach gelingt die Synthese von leitfähigem Polypyrrol (Bild 3).
Pyrrol kann auf elektrolytischem Wege zu einem leitenden Polymer oxydiert werden. Daher ist keine Dotierung erforderlich. Als Elektrolyt dient eine Lösung von Pyrrol und einer organischen Sulfonsäure in 2- Propanol.
Anwendungen
Kunststoffbatterie
Zunächst hatte man vor allem die Idee, wiederaufladbare Kunststoffbatterien zu entwickeln, da die Materialien nicht nur den Strom leiten, sondern auch Ladungen speichern können. Die BASF-AG hat schon 1986 auf der Kunststoffmesse eine derartige Batterie vorgestellt, bei der die positive Elektrode aus Polypyrrol besteht. Als Elektronendonator kommt Lithium in einem organischen Elektrolyten zum Einsatz. Die Spannung dieser wiederaufladbaren Batterie liegt bei etwa 3 V. Über einige hundert Lade- und Entladezyklen gleicht die Energiedichte der eines herkömmlichen Ni/Cd Akkumulators. Ein Vorteil einer Kunststoffbatterie und anderer Anwendungen leitender Kunststoffe wäre die Möglichkeit der beliebigen Formgebung.
-
Strukturausschnitt Polypyrrol
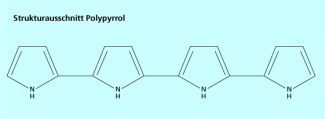
Neuere Entwicklungen führten zu elektrisch leitenden Polymeren, die nicht nur als Elektrodenmaterial für Akkumulatoren sondern auch für elektronische Bauteile genutzt werden. Heute werden leitfähige Kunststoffe insbesondere als antistatische Folien, elektromagnetische Abschirmungen in elektronischen Schaltkreisen und als Schutzschilde auf Bildschirmen, in Durchkontaktierungen von Leiterplatten in der Elektronikindustrie oder im Korrosionsschutz verwendet.
In der Zukunft ist gar ein Ersatz der herkömmlichen teuren Silicium-Chips durch maßgeschneiderte Kunststoffe denkbar oder auch ein aufrollbarer Bildschirm auf Folienbasis.

