Mittel der Raumdarstellung
Der Bildraum beinhaltet die Gliederung des Formates in räumliche Bezüge (Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund) und die Entscheidungen über die Mittel der Körper- und Raumdarstellungen auf der Bildfläche.
Die Schaffung von körperhaft-plastischer und räumlicher Illusion beim Betrachten von Bildern war das Ziel vieler Künstler in den verschiedenen Kunstepochen. Sie beruht auf den realen Raumerfahrungen des Betrachters. Um den Eindruck von Dreidimensionalität auf der zweidimensionalen Fläche zu erreichen, nutzt man unterschiedliche bildnerische Mittel.
1. Einfache Mittel der Raumdarstellung
Im Mittelalter gab es keine wahrnehmungsgetreue Raum- oder Körperdarstellung. Man bediente sich der Farbsymbolik (z.B. Gold als Farbe für Heilige) und Bedeutungsgröße (Rangordnung bestimmt die Größe der Figur) auf der einen Seite und einfacher Mittel zur räumlichen Tiefenwirkung auf der anderen Seite:
- Höhenunterschied:
Der Höhenunterschied von Objekten ist das älteste und einfachste Mittel der Raumdarstellung. Objekte, die im Bild unten angeordnet sind, befinden sich vorne, solche, die sich weiter oben befinden, hinten.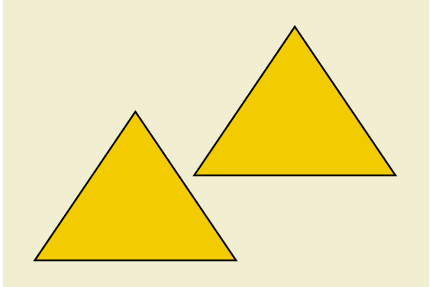
- Überdeckung:
Ein bereits in der antiken ägyptischen Wandmalerei eingesetztes Mittel ist die Überdeckung, die sich ebenfalls aus den räumlichen Seherfahrungen ableitet. Objekte mit teilweise verdeckten Formen scheinen sich weiter entfernt bzw. tiefer im Raum zu befinden als nicht verdeckte.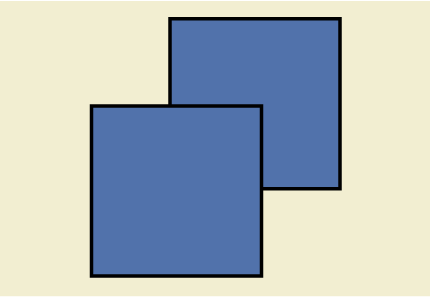
- Staffelung:
Findet eine Überdeckung von Bildobjekten in einer bestimmten Richtung und mit systematischen Abständen statt, spricht man von Staffelung.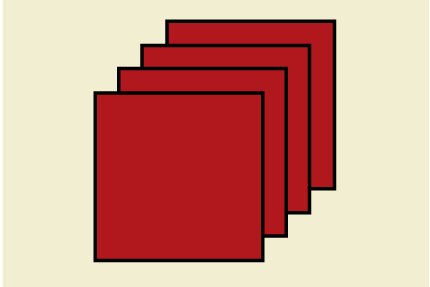
- Größenunterschied:
Werden Bildobjekte, die in der Realität gleich groß sind, auf der Bildebene unterschiedlich groß dargestellt (Größenunterschied), scheinen die kleineren Objekte weiter entfernt zu sein als die größeren. Findet diese bewusste Verkleinerung der Bildelemente von unten nach oben auf der Bildebene statt, erreicht man eine starke Tiefenräumlichkeit.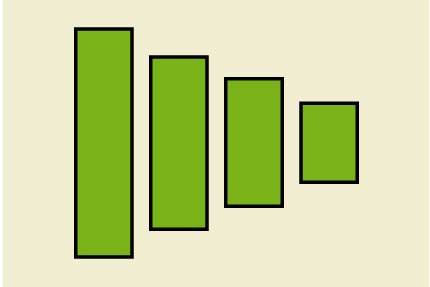
2. Raum- und Körperdarstellung durch Licht- und Schattenmodulation
Mittels bewusst eingesetzter Helligkeitsabstufungen von Hell zu Dunkel oder umgekehrt können Bildgegenstände plastisch erscheinen und räumliche Wirkungen erzielt werden. Die körperhafte Wirkung entsteht durch eine Licht-Schatten-Modulation.
-
REMBRANDT HARMENSZ. VAN RIJN: „Alter Mann im Lehnstuhl“;1654, Öl auf Leinwand, 108 × 86 cm;St. Petersburg, Eremitage.

Rembrandt Harmensz van Rijn - © 2003 The Yorck Project
Auf den dargestellten Flächen werden Lichteinfall, Reflexionen auf Oberflächen und Übergänge zu Schattenzonen durch kontinuierlich abgestufte Grauwerte, von leicht getrübtem Weiß bis zu stark getrübtem Schwarz, oder durch gedunkelte und gehellte Farbtöne wiedergegeben. Auf kugeligen Körpern werden so Glanzpunkte (sogenannte Highlights) und auf zylindrischen Körpern Glanzstreifen gesetzt.
-
TIZIAN: „Pietà“;um 1576, Öl auf Leinwand, 353 × 348 cm;Venedig, Gallerie dell'Accademia.

Tizian - © 2003 The Yorck Project
Ebene Flächen besitzen auf jeder Körperseite eine einheitliche Helligkeit im Farbton, während bei allen gerundeten Körpern ein stufenloser Übergang von Hell zu Dunkel stattfindet, bis hin zu den dunkelsten Körperpartien, auf die kein Licht fällt. Je größer der Helligkeitsunterschied zwischen den hellsten Bereichen und dem dunkelsten Körperschatten (= Schattenverläufe auf Objekten) ist, desto intensiver nimmt der Betrachter eine plastische Wirkung wahr. Durch die Darstellung von Außenschatten (Kernschatten, Halbschatten oder Schlagschatten) wird der Eindruck der Räumlichkeit verstärkt. Werden Objekte im Bild ohne Schlagschatten dargestellt, wirken sie raumlos.
Hinter beleuchteten lichtundurchlässigen Körpern bilden sich Schatten:
- Schlagschatten: Schatten, den ein beleuchteter Gegenstand auf seine Standfläche wirft,
- Kernschatten: dunkle Zone in der Nähe von Objekten,
- Halbschatten: Bereiche, die etwas weiter entfernt und heller sind.
-
DIEGO VELÁZQUEZ: „Drei Männer am Tisch“;um 1618, Öl auf Leinwand, 108,5 × 102 cm;St. Petersburg, Eremitage.(Schlagschatten und Körpermodulation)

Diego Veláquez - © 2003 The Yorck Project
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Größenunterschied
- Verkleinerung
- Tiefenwirkung
- Schatten
- verdeckt
- Schattenzonen
- Helligkeitsunterschied
- Höhenunterschied
- Überdeckung
- Glanzpunkte
- Bildfläche
- Farbtöne
- Außenschatten
- Mittelgrund
- Bedeutungsgröße
- Dreidimensionalität
- Reflexion
- Lichteinfall
- Illusion
- HalbschattenFormat
- Licht-Schatten-Modulation
- Schlagschatten
- Kernschatten
- Raumerfahrungen
- Bildraum
- Wandmalerei
- zweidimensional
- Staffelung
- Grauwerte
- Körperdarstellung
- Körperschatten
- Mittelalter
- Bildelement
- Vordergrund
- Raumdarstellung
- Glanzstreifen
- Farbsymbolik
- Helligkeitsabstufungen
- Hintergrund

