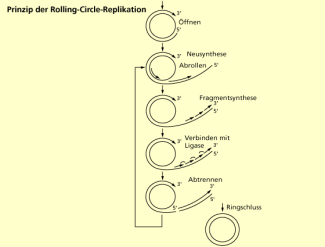Das „Rolling-Circle-Modell“ der Replikation bei Plasmiden und Phagen
Unter Rolling-Circle versteht man eine Form der DNA-Replikation bei ringförmigen DNA-Molekülen, wie beispielsweise Plasmiden oder bestimmter viraler DNA (wie z. B. bei einzelsträngigen DNA-Phagen). Die Rolling-Circle-Replikation ist neben dem Y-Modell ein weiteres Modell zur Erklärung der Replikation bei Bakteriophagen und einigen Plasmiden.
Bei der Vervielfältigung ringförmiger DNA wird zwischen der symmetrischen (Y-) und der Rolling-Circle-Replikation unterschieden. Bei der Replikation nach dem Y-Modell dienen beide DNA-Stränge als Matrize für die Neusynthese der DNA. Es bildet sich eine Replikationsgabel.
Nach dem Modell eines rollenden Kreises (englisch: rolling circle) findet die Replikation bei bestimmten Bakteriophagen mit ringförmiger DNA (z. B. Lambda X174) oder bei einigen Plasmiden statt.
Beim Rolling-Circle-Prinzip wird zunächst die einzelsträngige, kreisförmige DNA dieser Phagen, der sogenannte Plus-Strang, in die doppelsträngige, replikative Form überführt. Durch einen spezifisch gesetzten Bruch (englisch: nick) in dem Plus-Strang öffnet sich an der ringförmigen DNA ein Strang, an dessen 3'-Ende neue Nucleotide angefügt werden. Das freie 3'-OH-Ende dient den DNA-Polymerasen als Startstelle (englisch: primer) für die Replikation. Der zweite (Minus-)Strang, besser Ring, bleibt geschlossen und dient als Vorlage (Matrize) für die Neusynthese. Durch „Abrollen“ entsteht laufend ein neuer, einzelner DNA-Strang. Er wird in kleinen Fragmenten (Ozaki-Fragmenten) durch einen zweiten ergänzt. Nach Verknüpfung der Fragmente mittels Ligase liegt eine neue DNA-Doppelhelix vor, die nur noch zum Ring geschlossen werden muss.
Durch das „Rollen“ des geschlossenen Rings und das „Abrollen“ der neuen DNA können viele Kopien hintereinander an einer Matrize erzeugt werden und so kann von nur einem Minus-Strang eine Vielzahl von infektiösen Plus-Strängen entstehen.
Während bei der Konjugation von Bakterien, von Plasmiden in den Empfängerzellen und bei einer Reihe von Viren jeweils nur Einzelkopien entstehen, erfolgt beim Lambda-Phagen (B) mithilfe der Rolling-Circle-Replikation zunächst die Synthese langer linearer DNA-Stränge (Concatemer), die erst bei der Verpackung der DNA in die Phagenköpfe in einzelne Phagengenome zerfallen.
-
Verlauf der Rolling-Circle-Replikation