Untersuchungsmethoden der Verhaltensbiologie
Grundlegende Methoden der Verhaltensbiologie sind
- das Beobachten und Beschreiben von Verhalten
- konkrete Fragen formulieren
- Messen, Auswerten und Analysieren
- die quantitative Verhaltensregistrierung
- das Beschreiben von komplexen Verhaltensweisen (z. B. Soziale Strukturen und Organisationsformen)
Bevor man also darüber nachdenkt, warum ein Tier bzw. eine Tierart eine bestimmte Verhaltensweise ausübt, muss man wissen, was die Tierart insgesamt an Verhaltensrepertoire aufweist. Es muss ein Verhaltenskatalog (Ethogramm) erarbeitet werden, der das beobachtete Verhalten in konkrete, mehr oder weniger feine Kategorien unterteilt. Um ein Ethogramm aufstellen zu können, muss man intensiv beobachten und genau protokollieren. Diese Beobachtungen können abhängig von der Fragestellung im Freiland oder aber unter kontrollierten Bedingungen im Zoo oder Labor erfolgen.
Die Verhaltensbeschreibungen sollten frei von voreiligen, ungeprüften Interpretationen sein, und die Verhaltenselemente müssen eindeutig definiert werden. Bevor man also darüber nachdenkt, warum ein Tier bzw. eine Tierart eine bestimmte Verhaltensweise ausübt, muss man wissen, was die Tierart insgesamt an Verhaltensinventar aufweist.
Verhaltensweisen müssen als wiederkehrende Abläufe erkannt, definiert und möglichst interpretationsfrei benannt werden. Es muss ein Verhaltenskatalog (Ethogramm) erarbeitet werden, der das beobachtete Verhalten in konkrete, mehr oder weniger feine Kategorien unterteilt. Das Ethogramm kann je nach Fragestellung von der einfachen Muskelbewegung bis hin zu komplexen Verhaltensabfolgen alles beinhalten. Es ist also die erste notwendige Voraussetzung für das Beantworten konkreter Fragen in der Verhaltensbiologie. Art und Anzahl der dort aufgeführten Verhaltenselemente richtet sich also immer nach den zu beantwortenden Fragen:
- Wann am Tag sind Meerschweinchen aktiv? Die Unterscheidung in aktiv und inaktiv reicht aus, man muss jedoch klar definieren, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt.
- Wann am Tag singen Nachtigallen? Die Unterscheidung in Singen und Nicht-Singen ist ausreichend.
- Wie kommt ein Fuchs zu seiner Nahrung? Hier ist ein ausführlicher Katalog erforderlich: Beute- und Beerenstandorte des Fuchses ausmachen, Verhalten des Fuchses bei der Nahrungssuche analysieren: Wie beschafft er sich die Früchte bzw. wie bearbeitet er sie? Wie fängt er Mäuse, Hasen oder andere Tiere? Wie sucht er Futterplätze auf?
Ziel ist es, Zusammenhänge zu erkennen und zu „Wenn-dann-Sätzen“ zu formulieren. Indem man Verhaltensweisen definiert, bildet man konkrete Kategorien von Verhaltensabläufen. Verhaltensweisen, die man zählt oder misst, müssen klar definiert sein, damit auch Andere die Untersuchung nachvollziehen können. Ist eine Fragestellung zu einem bestimmten Verhaltensphänomen überprüfbar formuliert, kann gezielt beobachtet, gemessen, ausgewertet und analysiert werden. Zwecks Analyse der Ursachen werden einzelne Umweltfaktoren verändert, um die Reaktion des Tieres beobachten zu können. Experimente unter kontrollierten Bedingungen sind im Freiland zwar möglich, erfordern
aber auch Untersuchungen im Zoo oder Labor.
Grundlegende Methoden der Verhaltensbiologie sind
- das Beobachten und Beschreiben von Verhalten
- konkrete Fragen formulieren
- Messen, Auswerten und Analysieren
- die quantitative Verhaltensregistrierung
- das Beschreiben von komplexen Verhaltensweisen (z. B. Soziale Strukturen und Organisationsformen)
Es ist dabei unbedingt zu berücksichtigen, das Tiere sich in einer
künstlichen Umgebung anders als in ihrem natürlichen Habitat im Freiland verhalten. Die qualitativen Methoden des Beschreibens und Katalogisierens von Verhalten werden durch quantitative Untersuchungsmöglichkeiten sinnvoll ergänzt. Die ermittelten quantitativen Verhaltensdaten dienen dazu, eine formulierte Hypothese zu testen. Die konkrete Frage muss klar formuliert sein, ebenso, wie die Antwort dazu aussehen könnte. Die Null-Hypothese (Verhalten widerspricht der Erwartung) und die konträre Alternativ-Hypothese (Verhalten entspricht der Erwartung) sollte formuliert sein, bevor man mit dem Sammeln der Daten beginnt. Welche statistischen Tests sind für das Versuchsdesign sinnvoll, ebenso die Beantwortung der Frage:
WAS registriere ich WIE, WO und WANN bei WEM?
Abhängig von der Fragestellung müssen die im Ethogramm definierten
Verhaltensweisen als Zustände (Aktivitäten), Ereignisse (Episoden), Zeitanteil oder Häufigkeiten registriert werden.
Beschreibung und Kategorienbildung komplexer Verhaltensweisen (z. B. soziale Organisationsform)
Bei der Beantwortung der Frage „Wer tut was gegen wen?“ müssen folgende Arbeitsschritte erfolgen:
- Aufstellung der Art und Häufigkeit der Verhaltensweisen
- Beschreiben der sozialen Organisationsform (Definition der Alters- und Geschlechtsklassen, der sozialen Einheit....)
- Statistische Absicherung der beobachteten Unterschiede in den Beziehungen
Von der jeweiligen Fragestellung ist abhängig, welche Methode für die Untersuchung sinnvoll ist. Will man z. B. etwas über die neurophysiologischen Prozesse bei der Durchführung einer Handlung erfahren, kommt nur ein Laborversuch in Frage. Wenn man herausfinden will, ob eine Verhaltensweise angeboren ist, wird man alle äußeren Einflüsse, die es dem Tier ermöglichen könnten zu lernen bzw. Erfahrungen zu machen, fern halten. Problematisch dabei ist allerdings, dass das Versuchstier in eine unnatürliche Umgebung gesetzt wird. Alle Fehlerquellen sollten sorgfältig registriert werden. Um zu einer abschließenden Beurteilung zu kommen, muss man meist die Ergebnisse verschiedener Methoden zusammenfassen.
Untersuchungsmethoden
Kaspar-Hauser-Experiment
Untersuchungsmethode:
Tiere werden isoliert aufgezogen, um angeborenes und erlerntes Verhalten zu untersuchen. Das heißt, sobald das Tier geschlüpft oder geboren ist, wird es isoliert von Eltern, Geschwistern und anderen Artgenossen aufgezogen, um keine Gelegenheit zu haben, von ihnen zu lernen. Auch die Umgebung wird möglichst reizarm gestaltet, um sicherzustellen, dass das gezeigte Verhalten ausschließlich auf genetischer Programmierung beruht.
Problem:
Die Aufzucht erfolgt unter völlig unnatürlichen Bedingungen. Für komplexe Verhaltensweisen (z. B. aus dem Bereich der sozialen Organisation/Sozialverhalten) ist diese Untersuchungsmethode ohnehin völlig ungeeignet, da der Einfluss der Artgenossen durch die Schaffung dieser unnatürlichen Versuchsbedingungen ausgeschlossen ist. Das Versuchstier entwickelt sich völlig untypisch und äußert Verhaltensweisen, die nichts mit dem natürlichen Verhaltensinventar dieser Tiere zu tun haben. So weisen z. B. von ihren Artgenossen isoliert aufgezogene Primatenkinder massive Verhaltensstörungen auf, die auch im Erwachsenenalter nicht zurückgehen. Diese Vorgehensweise ist in gewisser Weise verantwortungslos, da man Psychopathen produziert, die man nur äußerst schwer oder gar nicht in eine Gruppe integrieren kann.
Beispiel:
Werden isoliert gehaltene Eichhörnchen mit pulvrigem Futter aufgezogen, haben sie keine Möglichkeit, das Vergraben von Nüssen zu lernen. Die erste Nuss, die sie bekommen, vergraben sie wie ein erfahrenes Tier: Es wird gescharrt, die Nuss wird abgelgt, zugedeckt und abschließend wird der Boden festgestoßen. Die Abfolge dieser Bewegungen ist also angeboren.
Attrappenversuch
Untersuchungsmethode:
Mithilfe von sogenannten Attrappen (= Objekten, die bestimmte Eigenschaften eines Gegenstandes charakterisieren) wird untersucht, welche Eigenschaft ein Schlüsselreiz hat. Da man davon ausgeht, dass es angeborene Nervenprogramme (Reizmerkmale werden registriert und anschließend kommt es zur Auslösung einer Reaktion = AAM: Angeborener auslösender Mechanismus) gibt, versucht man die Reizstruktur zu erkennen, indem man dem Versuchstier ein realistisches Abbild des reaktionsauslösenden Reizes (Attrappe) anbietet. In weiteren Versuchen kann man die Eigenschaften des auslösenden Objektes immer mehr zurücknehmen, bis schließlich nur noch eine minimale Reizstruktur übrig bleibt, auf die das Tier gerade noch reagiert. Diese Eigenschaft des auslösenden Objektes bezeichnet man als Schlüsselreiz für das betreffende Verhalten.
Problem:
Auch hier existieren unnatürliche Versuchsbedingungen. Die Tiere könnten während der Versuchsabfolge dazu lernen, sie könnten ermüden und dann anders reagieren. Außerdem weiß man nie genau welche Erfahrungen bezüglich der untersuchten Situation vorhanden sind. Wenn man diese Versuche im Freiland mit wild lebenden Tieren durchführt, kann niemand garantieren, dass die Tiere bezüglich der untersuchten Situation noch keinerlei Erfahrungen gesammelt haben.
Beispiel:
NIKOLAAS TINBERGEN hat die Reaktionen von Silbermöwenküken auf die Schnabelfärbung der Elterntiere untersucht. Aus seinen Versuchen schloss er, dass der rote Fleck an der Unterseite des Elternschnabels ein Schlüsselreiz dafür ist, dass die Küken zwecks Futterbetteln an den Schnabel der Eltern picken.
Zootier- und Labortierexperimente; Experimente mit zahmen Tieren
Untersuchungsmethode:
Die Versuchsbedingungen sollen kontrollierbar aber auch möglichst natürlich sein, was unter den gegebenen Umständen nur schwer vorstellbar ist. Während ich im Labor durch das gezielte Einsetzen von Apparaturen die Bedingungen detailliert vorgeben kann (so kann man im Labor z. B. mithilfe von Messinstrumenten physiologische Reaktionen des Versuchstieres aufzeichnen), ist das Beobachten von Tieren im Zoo mit möglichst naturnaher, artgerechter Umgebung der Kompromiss zwischen der Beobachtung von zahmen Tieren und Beobachtungen im Freiland.
Problem:
Die Reaktionen der Tiere sind nicht natürlich. Der Mensch spielt eine zu große Rolle bis dahin, dass er einem Versuchstier in der Laborapparatur Schaden zufügen kann. Auch die Organisationsstrukturen bzw. Sozialstrukturen von Zootierpopulationen entsprechen oft nicht den natürlichen Bedingungen.
Beispiel:
Klassisches Beispiel für Laborversuche sind die Experimente von B.F. Skinner mit Tieren, die er in der von ihm entwickelten Skinner-Box durchführte. Mithilfe dieser Apparatur lernen z. B. Ratten, bestimmte Tasten der Box zu betätigen, um Nahrung zu bekommen. KONRAD LORENZ wurde bekannt dadurch, mit zahmen Tieren (Schneegänsen, Graugänsen) zu experimentieren.
Molekularbiologische und technische Methoden
Untersuchungsmethode:
- Tragbare Sender ermöglichen eine Überwachung von Tieren aus großer Entfernung oder in unübersichtlichem Terrain. Die Technik ist mittlerweile sogar in der Lage, mithilfe dieser Methode fliegende Tiere mit Kleinflugzeugen zu begleiten.
- Endoskopische Kameras bieten detaillierte Aufnahmen der Bausysteme von sehr kleinen Tieren.
- Anhand chemischer Nachweismethoden lassen sich in Kot- und Urinproben z. B. Hormone nachweisen.
- Anhand von DNA-Spuren des Einzelindividuums, die aus dem Kot, dem Speichel und den Haaren gewonnen werden können, sind verwandtschaftliche Beziehungen nachweisbar. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom „genetischen Fingerabdruck“
Problem:
Hierbei handelt es sich meist um sehr aufwendige und kostenintensive Methoden. Häufig wird im Forscherteam gearbeitet, da die Kompetenzen bezüglich der Nutzung der Hilfsmittel sehr spezifisch sind.
Beispiel:
Mithilfe der Methode des genetischen Fingerabdrucks können Vaterschaftstests gemacht werden, die wichtige Informationen über die direkte Fitness (den Reproduktions- oder Fortpflanzungserfolg) männlicher Tiere liefern.
Freilandbeobachtungen
Untersuchungsmethode:
Diese Beobachtungsmethode ist die geeignetste, aber auch aufwendigste Art und Weise, das Verhalten von Tieren zu studieren. In der Regel sind Langzeitstudien nötig, die Forscher verbringen häufig viele Jahre mit den Tieren, weit weg von Freunden, Familie und oft auch von der Zivilisation. Die Tiere werden anfangs aus der Ferne beobachtet, gewöhnen sich aber in der Regel mit der Zeit an den Anblick und Geruch des Beobachters (Habituation). Als Beobachter sollte man jedoch auf jeden Fall vermeiden, in die soziale Struktur als Gruppenmitglied aufgenommen und somit wie ein Artgenosse behandelt zu werden.
Problem:
Diese Methode liefert die authentischsten Ergebnisse. Nur durch langfristige Verhaltensbeobachtungen im Freiland war es möglich etwas über die sozialen Strukturen vieler Tierarten unter natürlichen Bedingungen und abhängig von den ökologischen Bedingungen zu erfahren. Bestimmte Fragestellungen können allerdings nur auf experimentelle Art und Weise geklärt werden.
Beispiel:
Drei Frauen, die sich mit dem Leben unserer nächsten Verwandten, den Menschenaffen beschäftigt haben, sollen mit ihrem Lebenswerk genannt werden:
- Die Engländerin JANE GOODALL, die seit Anfang der 60er-Jahre die sozialen Strukturen frei lebender Schimpansen im Gombe Nationalpark in Tansania (Afrika) untersucht.
- Die Amerikanerin DIAN FOSSEY, die im Dreiländereck Ruanda-Uganda-Zaire (Afrika) die Forschungsstation Karisoke aufbaute, um dort die vom Aussterben stark bedrohten Berggorillas zu beobachten. Dian Fossey war von dem Aussterben bedrohten Tiere so fasziniert, dass sie 22 Jahre lang, bis zu ihrem Tod, dort blieb und ihr Leben den Tieren widmete. Sie wurde im Alter von 53 Jahren am 26. Dezember 1985 im Dschungel von Ruanda brutal ermordet.
- Die Kanadierin BIRUTÉ GALDIKAS, die seit den 70er-Jahren die Orang Utans in den Urwäldern von Borneo (Indonesien) beobachtet.
-
Kategorien für das Beschreiben sozialer Organisationsformen
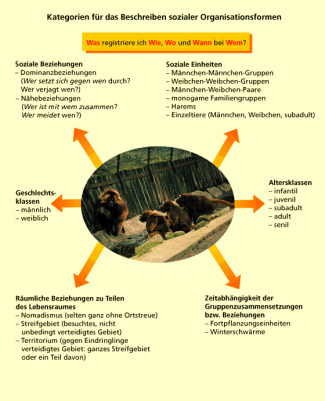
aussieanouk
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Attrappenversuch
- Galdikas> Birutä; genetischer Fingerabdruck; Goodall> Jane; Kaspar-Hauser-Experiment
- Experimente mit zahmen Tieren
- Zootierexperimente
- Kategorienbildung für die soziale Organisationsformen
- AAM
- Verhaltenskatalog
- Fragestellung
- Skinner> B.R; Tinbergen> Nikolaas; Untersuchungsmethoden
- Molekularbiologische Methoden
- Labortierexperimente
- quantitative Untersuchungsmöglichkeiten
- Ethogramm
- Verhaltensweisen
- Fossey> Dian; Freilandbeobachtungen
- Lorenz> Konrad; Methoden> Verhaltensbiologie

