Vollwert-Ernährung
Die Vollwert-Ernährung als besondere Kostform beruht darauf, dass alle Lebensmittel je nach dem Grad ihrer Verarbeitung in ein Wertsystem eingeordnet werden.
Vollwert-Ernährung nach WERNER KOLLATH (1892–1970) betrachtet Ernährung ganzheitlich auch unter ökologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Gesichtspunkten. Lacto-vegetarischer Kost wird der Vorzug gegeben. Angestrebt wird eine weitgehende Naturbelassenheit aller Produkte. Bestrahlung von Lebensmitteln, technologische oder gentechnische Veränderungen, Zusatzstoffe werden abgelehnt.
Aus ökologischen Betrachtungen heraus ergibt sich die Forderung, möglichst Produkte der Region zu verwenden. Auch die Verpackung der Lebensmittel sollte angemessen sein.
Lebensmittel werden in vier verschiedene Wertigkeiten unterteilt.
„Vollwerternährung“ – dieser Begriff ist von WERNER KOLLATH im Jahre 1942 geprägt worden. Er strebte eine ganzheitlich zu betrachtende Ernährung an. Damit steht er in der Tradition von Theorien des Hippokrates. Das rein wissenschaftliche Bild des vollen Wertes der Nahrung wird erweitert. Vollwertkost nach KOLLATH ist mehr als die Summe ihrer physikalischen, chemischen und physiologischen Teilwerte.
Vollwert-Ernährung hat auch ökologische, gesellschaftliche, kulturelle und ökonomische Aspekte. Daraus folgt, dass Nahrung möglichst frisch und wenig weiterverarbeitet aufgenommen werden sollte.
Lacto-vegetarischer Kost wird der Vorzug gegeben. Dazu gehören gering verarbeitete Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Die Hälfte der Nahrung sollte aus unerhitzter Rohkost bestehen. Kartoffeln, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte werden empfohlen. Milch und ihre Produkte sind anerkannt. Fleisch, Fisch und Eier sollten in Maßen genossen werden. Fett, besonders tierisches, wird weitgehend vermieden. Auf die Naturbelassenheit aller Produkte wird großer Wert gelegt.
Deshalb sind sämtliche Zusatzstoffe zu Nahrungsmitteln zu vermeiden. Sie täuschen eine nicht vorhandene Qualität der Lebensmittel vor. Lebensmittel sollten nicht technologisch oder gentechnisch verändert sein. Dazu gehört auch food-design oder Bestrahlung.
-
Einteilung der Lebensmittel nach Wertstufen
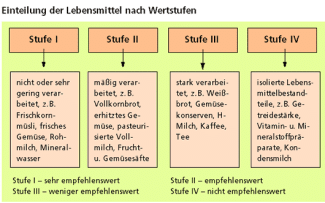
Aus ökologischen Betrachtungen heraus ergibt sich die Forderung, möglichst Produkte der Region zu verwenden. Auch eine sinnvolle jahreszeitliche Zusammensetzung der Nahrung ist wünschenswert. Die Verpackung der Lebensmittel sollte angemessen sein.
Die Auswirkungen industriell hergestellter Nahrung sowie der reichliche Zucker- und Salzkonsum werden kritisch betrachtet. Eine Veränderung unserer Geschmackskultur, weg von Süßem und Salzigem, wird empfohlen. Es ist auf eine ausgewogene Zusammenstellung unter Beachtung des regionalen Angebotes zu achten.
Die Nahrungsmittel werden heute in vier verschiedene Wertstufen unterteilt.
Stufe I: sehr empfehlenswert (unerhitzte Speisen, Mineralwasser, rohes Obst und Gemüse, frische Milch)
-
Rohes Obst und Gemüse gehören zu Stufe I.

Stufe II: empfehlenswert (mäßig verarbeitet, Frucht- und Gemüsesäfte, Vollkornbrot)
-
Vollkornbrot und Obstsaft gehören zu Stufe II.

Stufe III: weniger empfehlenswert (Kaffee, Tee, Konserven, Weißbrot)
Stufe IV: nicht empfehlenswert (isolierter Zucker, Kondensmilch, Schlankheitsdrinks, künstliche Süßstoffe)
Die Vollwerternährung bringt unsere Nahrungsmittel in ein System, berücksichtigt aber nicht nur ihren physiologischen Wert. So geht beispielsweise auch der Aufwand, der zur Herstellung der Nahrung notwendig ist, in die Wertigkeit des Lebensmittels mit ein. Zur Gesunderhaltung des Menschen und seiner Umwelt wird deshalb allen naturbelassenen Lebensmitteln der Vorzug gegeben.
-
Künstliche Süßstoffe gehören nicht zur Vollwerternährung.
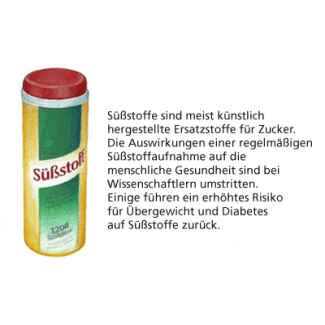
MEV Verlag, Augsburg

