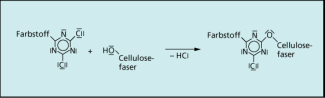Färbeverfahren
Zum Färben von Garnen und Stoffen gibt es verschiedene Färbeverfahren. Ihre Anwendung hängt von der Art der Fasern und den Eigenschaften des verwendeten Farbstoffs ab. Es lassen sich drei Gruppen von Färbeverfahren unterscheiden: Die Direktfärbung, bei der der unbehandelte Stoff in eine Lösung des Farbstoffs getaucht wird, die Entwicklungsfärbung, bei der der Farbstoff erst auf der Faser entsteht, und die Dispersionsfärbung, bei der der Farbstoff in der Faser gelöst wird.
Die Art des Färbeverfahrens richtet sich sowohl nach den Eigenschaften der Farbstoffe als auch nach denen der Textilfasern. Bestimmte Farbstoffe eignen sich gut für manche Fasern und für andere überhaupt nicht. Dasselbe gilt für die Färbeverfahren. Es lassen sich bei weitem nicht alle Methoden für jeden Farbstoff bzw. jeden Textilstoff anwenden.
-
Um farbenprächtige Stoffe zu erhalten, nutzt man unterschiedliche Färbeverfahren.

1. Direktfärbung
Bei der Direktfärbung unterscheidet man zwischen der substanziellen Direktfärbung und der ionischen Direktfärbung. Gemeinsam ist beiden Verfahren, dass der wasserlösliche Farbstoff direkt aus dem Färbebad auf die Faser aufzieht. Es ist keine Vorbehandlung der Faser nötig.
Bei der substanziellen Direktfärbung, die bei Baumwolle und Cellulosefasern angewendet werden kann, haftet der Farbstoff nur durch van-der-Waals-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindungen an der Faser. Daher sind Stoffe, die mit dieser Färbemethode gefärbt worden sind, nicht waschecht. Zu den substanziellen Farbstoffen zählen vor allem Azofarbstoffe und Anthrachinonfarbstoffe.
Von ionischer Direktfärbung spricht man, wenn die Farbstoffmoleküle eine Ladung tragen, wie z. B. Kristallviolett, das positiv geladen ist, oder Methylorange, das eine negative Ladung hat. Solche Farbstoffe können mit entgegengesetzt geladenen Atomgruppen der Fasern Ionenbindungen eingehen. Proteinfasern wie Wolle oder Seide können auf diese Weise gut gefärbt werden.
-
Übersicht über die verschiedenen Färbeverfahren
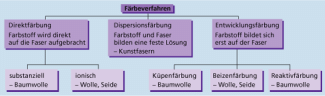
2. Entwicklungsfärbung
Im Gegensatz zu den Direktfarbstoffen entstehen die Entwicklungsfarbstoffe erst auf der Faser. Es sind häufig Azofarbstoffe. Für ihre Herstellung benötigt man zwei Komponenten, nämlich einen Aromaten als Kupplungskomponente und ein aromatisches Diazoniumsalz. Die Kupplungskomponente wird im basischen, wässrigen Medium gelöst. Die Fasern, bei denen es sich meistens um Cellulosefasern handelt, werden damit durchtränkt und dann getrocknet. Anschließend werden sie mit der Lösung des Diazoniumsalzes behandelt. Die Kupplungsreaktion, bei der der Farbstoff entsteht, findet somit auf der Faser statt (Bild 3). Wie auch die Küpenfarbstoffe sind die Entwicklungsfarbstoffe nicht wasserlöslich und daher sehr waschecht.
Als Kupplungskomponente wird häufig Naphtol® AS (3-Hydroxy-2-naphthoesäureanilid), ein Derivat des Naphthalins, verwendet, weswegen man auch von Naphtol-AS-Farbstoffen spricht.
-
Ablauf der Azokupplung
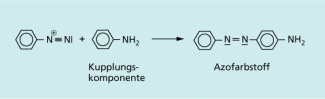
Küpenfärbung
Die Küpenfärbung ist eine besondere Art der Entwicklungsfärbung. Küpenfarbstoffe, deren wichtigster Vertreter Indigo ist, sind wasserunlöslich und können daher nicht direkt auf die Fasern aufgebracht werden. Man überführt sie daher zunächst mit einem Reduktionsmittel, z. B. Natriumdithionit , in eine wasserlösliche Form. Da die reduzierte Form meist nicht mehr farbig ist, wird sie Leukoform (von griech. leukos = weiß) genannt.![]() Mit der Lösung kann wie bei einer Direktfärbung weiterverfahren werden. Während der Trocknung des Färbeguts wird die Leukoform des Farbstoffes durch den Luftsauerstoff wieder oxidiert und erhält seine Farbigkeit zurück. Dieser Vorgang lässt sich natürlich durch die Behandlung mit Oxidationsmitteln beschleunigen. Da sie nicht wasserlöslich sind, besitzen diese Farbstoffe eine höhere Waschechtheit als die oben genannten Direktfarbstoffe. Trotzdem bleichen indigogefärbte Stoffe mit der Zeit aus, weil der Farbstoff nur aufgrund von van-der-Waals-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindungen an der Faser haftet und sich durch mechanische Belastung von ihr löst.
Mit der Lösung kann wie bei einer Direktfärbung weiterverfahren werden. Während der Trocknung des Färbeguts wird die Leukoform des Farbstoffes durch den Luftsauerstoff wieder oxidiert und erhält seine Farbigkeit zurück. Dieser Vorgang lässt sich natürlich durch die Behandlung mit Oxidationsmitteln beschleunigen. Da sie nicht wasserlöslich sind, besitzen diese Farbstoffe eine höhere Waschechtheit als die oben genannten Direktfarbstoffe. Trotzdem bleichen indigogefärbte Stoffe mit der Zeit aus, weil der Farbstoff nur aufgrund von van-der-Waals-Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindungen an der Faser haftet und sich durch mechanische Belastung von ihr löst.
Beizenfärbung
Eine besondere Art der Entwicklungsfärbung ist die Beizenfärbung. Hierbei werden die Fasern vor der Behandlung mit dem Farbstoff „gebeizt“, d. h. mit metallsalzhaltigen Lösungen vorbehandelt. Hierfür werden häufig Aluminium- und Eisensalze eingesetzt. Die Metallsalze lagern sich in die Fasern ein und bilden mit den Farbstoffmolekülen stabile Chelatkomplexe. Die Beizenfärbung findet vor allem bei Wolle Anwendung, weil die Amino-Gruppen der Peptidketten, die in der Proteinfaser Wolle vorkommen, im Farbkomplex als Liganden eingebunden sind und der Farbstoff daher besonders gut an den Fasern haftet (Bild 5).
Reaktivfärbung
Eine relativ neue Färbemethode ist die Reaktivfärbung. Der Farbstoff besitzt eine reaktive Gruppe, die mit der Farbigkeit selbst nichts zu tun hat. Diese reaktive Gruppe ist in der Lage, mit den Hydroxy-Gruppen von Cellulosefasern eine Atombindung einzugehen. Eine wichtige reaktive Gruppe ist der Dichlortriazin-Rest. Er reagiert unter Abspaltung eines Chloratoms mit der Cellulosefaser (Bild 5). Dadurch ist der Farbstoff besonders fest mit der Faser verknüpft, sodass eine sehr haltbare Färbung entsteht.
3. Dispersionsfärbung
Die Dispersionsfärbung wird bei unpolaren Fasern wie z. B. Polyesterfasern angewandt. Die wasserunlöslichen Farbstoffe, bei denen es sich in der Regel um Azofarbstoffe handelt, werden mit Hilfsstoffen zu einer Suspension verarbeitet. Die Fasern „extrahieren“ die Farbstoffmoleküle sozusagen aus der Suspension. Sie diffundieren in die Faser hinein, wodurch eine sehr waschechte Färbung entsteht.
-
Bei der Reaktivfärbung wird der Farbstoff über eine kovalente Bindung an die Faser gebunden.