Harnstoffzyklus
Eiweiße und Nucleinsäuren enthalten Stickstoff in Form von Aminogruppen (). Beim Abbau dieser Moleküle im Stoffwechsel entsteht giftiges Ammoniak , das gelöst in Form von Ammoniumionen vorliegt. Durch die Bildung von Harnstoff unter Bindung von in den Leberzellen in zyklischen Reaktionen erfolgt ein Unschädlichmachen des Ammoniaks (Entgiftung) und ein Abführen aus dem Körper. Einer der dabei entstehenden Stoffe, Fumarat, stellt die Verbindung zum Citratzyklus her. Über Fumarat kann der Harnstoffzyklus auch zur Gluconeogenese sowie zur Bildung von Citrat und Oxalat dienen.
Beim Abbau von Proteinen, DNA und RNA entsteht aus den Aminogruppen () dieser Verbindungen das für die Zelle sehr giftige Ammoniak (). Als unvermeidliches Nebenprodukt des Stoffwechsels muss es deshalb schnellstens aus dem Körper entfernt werden.
Die Ausscheidung von Ammoniak erfolgt über Harnsäure oder Harnstoff. Den einfachsten Weg beschreiten die meisten Wassertiere einschließlich vieler Knochenfische. Sie geben das gebildete Ammoniak sofort über die Körperflüssigkeiten an das Wasser ab. Vögel, Insekten, viele Reptilien und Landschnecken bilden Harnsäure . Sie ist weniger giftig, kann länger im Körper gehalten werden und führt zur Einsparung von Wasser.
Säuger, Haie, die meisten Amphibien und manche Knochenfische bilden Harnstoff, der über die Nieren ausgeschieden wird.
![]()
HANS KREBS und sein damaliger Student K. HENSELEIT entdeckten den Bildungsprozess von Harnstoff im Harnstoffzyklus und veröffentlichten 1932 ihre Erkenntnisse, einige Jahre vor der Entdeckung des Citratzyklus.
Der Harnstoffzyklus (Ornithinzyklus) besteht aus 4 zyklischen Reaktionen, in deren Verlauf aus Ammoniak, Aminstickstoff von Aspartat und Kohlenstoffdioxid der ungiftige Harnstoff entsteht.
Fünf Enzyme sind an den Umsetzungen beteiligt. Die Reaktionen verlaufen unter Energieverbrauch und benötigen die Energie von 3 ATP-Molekülen je Zyklus.
-
Vereinfachte Darstellung des Harnstoffzyklus
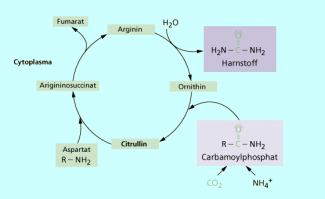
Die Reaktionen finden in der Mitochondrien-Matrix und im Cytoplasma von Leberzellen statt. Dabei gelangt Ammoniak in Form von Ammonium-Ionen und Kohlenstoffdioxid über die Verbindung Carbamoylphosphat in den Zyklus. Außerdem wird als Aspartat im Zyklus benötigt. Über die vier Zwischenverbindungen Citrullin, Argininosuccinat, Arginin und Ornithin wird und zu Harnstoff abgebaut.
Das Ammoniak und das stammen aus dem Abbau von Aminosäuren. Unter physiologischen Bedingungen liegt Ammoniak als vor. Unter Bindung eines Phosphatrestes aus ATP reagieren und zu Carbamoylphosphat. Ein zweites Molekül ATP liefert die Energie.
Unter Abspaltung von Phosphat wird die Carbamoylgruppe auf Ornithin übertragen, so dass Citrullin entsteht. Hier tritt Aspartat in den Kreislauf und reagiert mit Citrullin zu Argininosuccinat. Angetrieben wird die Reaktion durch Spaltung von ATP in AMP und 2 P.
Schließlich spaltet sich Argininosuccinat in Arginin und Fumarat. Arginin ist die unmittelbare Vorstufe von Harnstoff. Durch Wasseraufnahme entsteht aus Arginin Ornithin und Harnstoff.
Summengleichung:
Eine besondere Bedeutung hat das Fumarat , das aus dem Zyklus abgespalten wird. Es bildet die Verbindung zum Citratzyklus. Dabei kann es mehrere Wege einschlagen:
- Aus Fumarat entsteht über Malat und Oxalacetat wieder Aspartat für den Harnstoffzyklus.
- Fumarat geht über Malat und Oxalat in die Gluconeogenese zur Glucosegewinnung.
- Fumarat wird über Malat und Oxalat zu Pyruvat.
- Fumarat reagiert über Malat und Oxalat mit Acetyl-CoA zu Citrat.
Hauptort des Harnstoffzyklus ist die Leber. Die Umwandlungen erfolgen in der mitochondrialen Matrix, alle anderen Reaktionen laufen im Cytoplasma ab. Einige Stoffe werden auch von der Leber zur Niere transportiert und dort weiter verarbeitet.
Bereits bei Prokaryoten können alle beteiligten Enzyme nachgewiesen werden. Die evolutionär primäre Funktion des Harnstoffzyklus war die Synthese von Arginin. Dieses stellt als Argininphosphat eine wichtige energiereiche Verbindung bei Wirbellosen dar. Alle Tiere, die den Harnstoffwechsel verloren haben (Krebstiere, Insekten, Reptilien), benötigen Arginin als essenzielle Aminosäure.

