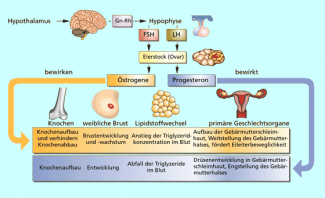Hormone
Die Bezeichnung „Hormone“ stammt aus dem Griechischen, bedeutet soviel wie Antriebsstoffe und wurde 1905 von E.H. STARLING erstmalig eingeführt. Der Mensch produziert etwa 50 Hormone, die Körperfunktionen, Entwicklung und Wachstum koordinieren.
Im jugendlichen Alter finden gravierende Umstellungen der Funktionen des endokrinen Systems statt, die sowohl äußerliche Körpermerkmale als auch das Verhalten verändern. Viele Jugendliche wissen dann eigentlich gar nicht, was mit ihnen passiert. Sie müssen sich an ein anderes Aussehen gewöhnen, sind launisch, schnell gereizt, z. T. aggressiv, lustlos, provokant. Das ist eine schwere Zeit und häufig ist die Ursache für diese Stimmungsschwankungen unklar.
Hormone als koordinative Signalstoffe
Der britische Physiologe ERNEST HENRY STARLING (1866-1927) führte 1905 den Begriff „Hormon“ ein. Das Wort stammt aus dem Griechischen (hormon – antreibend) und bezeichnet chemische Signalstoffe, die die Koordination der Körperfunktionen sichern.
Hormone der Tiere und Menschen beeinflussen den Stoffwechsel und den Energiehaushalt, fördern bzw. hemmen das Wachstum und die Entwicklung und nehmen Einfluss auf die Homöostase (physiologisches Gleichgewicht) und das Verhalten.
Hormone und die Hormone produzierenden Drüsen und Zellen bilden das endokrine System. Im Vergleich mit dem Nervensystem ist die Koordinationswirkung des endokrinen Systems langsamer, lang anhaltender und lokal (räumlich) weniger begrenzt. Endokrines System und Nervensystem stehen in funktioneller Verbindung.
Die Hormonwirkung an den Zielorganen wird durch die Bildung von Hormon-Rezeptor-Komplexen erreicht. Hormone werden nach der Ähnlichkeit ihrer chemischen Struktur, nach ihrem Bildungsort oder ihrer Funktion unterschieden.
Hormone der Pflanzen (Phytohormone) beeinflussen das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen. Pheromone sind chemische Signalstoffe, die der Übermittlung von Signalen zwischen Tieren derselben Art dienen. Von Pflanzen kennt man ähnliche Signalstoffe, die sogar zwischen verschiedenen Arten wirken (Allomone).
Das endokrine System der Wirbeltiere und des Menschen
Unter dem Begriff endokrines System werden alle Hormone und die sie produzierenden Zellen, Gewebe und Hormondrüsen zusammengefasst. Das endokrine System ist ein wichtiges Koordinationssystem, das den Stoffwechsel, den Energiehaushalt, das Wachstum, die Entwicklung, die Homöostase und das Verhalten beeinflusst.
Hormone sind chemische Signalstoffe, die von den Bildungsorten ins Blut oder in die Zwischenzellflüssigkeiten abgegeben werden und in kleinsten Mengen wirken.
Klassifizierung der Hormone
Nach ihrem Bildungsort unterscheidet man Drüsenhormone und Gewebshormone. Hormone werden auch nach ihren Wirkungsschwerpunkten eingeteilt: kinetische Wirkung, morphologische Wirkung, Stoffwechsel- und Verhaltenswirkung. Die Ähnlichkeit ihrer chemischen Struktur führt zur Klassifizierung in lipophile Steroidhormone und in von Aminosäuren abgeleitete hydrophile Hormone (Derivate einzelner Aminosäuren, Peptidhormone und Proteinhormone). Ihre Funktion und ihr Bildungsort sind in der Tabelle (Bild 2) zusammengefasst.
Hormone werden an ihrem Zielort an spezifisch Rezeptormoleküle gebunden, wodurch ein Signalmechanismus auf zellulärer Ebene ausgelöst wird. Der zelluläre Wirkungsmechanismus der Hormone beruht auf zwei Hauptwegen:
Lipophile Steroidhormone wirken im Zellkern und führen zu lang anhaltenden Änderungen der Proteinsynthese.
Hydrophile Hormone haben zeitlich begrenzte Wirkung über Second-Messenger.
Spezielle Hormone und ihre Wirkungen
Beispiele für Stoffwechselhormone (metabolische Hormone) sind Thyroxin, Insulin, Glukagon, Adrenalin und Glucocorticoide.
Thyroxin (Tetrajodhyronin) und Trijodhyronin werden im Schilddrüsengewebe aus der Aminosäure Thyrosin und 3 bzw. 4 Jodatomen gebildet. Jod muss über die Nahrung aufgenommen werden.
Die beiden Schilddrüsenhormone wirken auf zwei Weisen: Zum einen erhöhen sie den Energieumsatz des menschlichen Körpers und passen ihn somit an Kälte und Aktivität an, zum anderen hemmen sie die Hormonausschüttung aus Hypothalamus und Hypophyse, durch welche sie ursprünglich zum Arbeiten angeregt wurden. Diesen Vorgang nennt man negative Rückkoppelung.
Über die Stoffwechselbeschleunigung hat Thyroxin auch Einfluss auf Wachstum und Entwicklung.
Insulin steuert den Kohlenhydratstoffwechsel. Es wird in den langerhansschen Inseln des Pankreas (Bauchspeicheldrüse) gebildet und ist als einziges Hormon in der Lage, den Blutzuckerspiegel zu senken (Sollwert des Menschen liegt bei 0,9 mg/ml). Dies geschieht durch die Fähigkeit zur Steigerung der Membrandurchlässigkeit für Glucose (Zucker), womit sie schneller ins Zellinnere und damit zum Abbauort befördert werden kann. Des Weiteren aktiviert Insulin Enzyme, welche die Glykogenbildung und -speicherung aus Glucose fördern und die Fettumwandlung aus Zucker erhöhen.
-
Schematische Darstellung der Beziehungen zwischen Schilddrüse und anderen Hormondrüsen
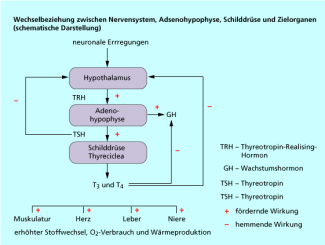
-
Wichtige endokrine Drüsen und Hormone der Wirbeltiere
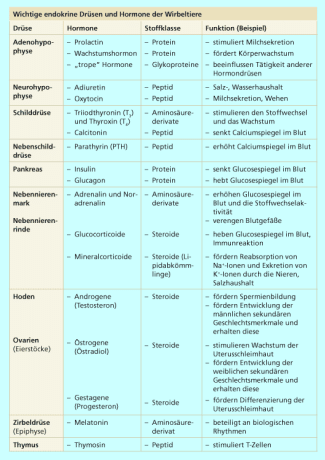
Glukagon ist ebenfalls ein Hormon der langerhansschen Inseln des Pankreas, es erhöht den Blutzuckerspiegel bei Zuckermangel durch Glykogenabbau (Glykogenolyse), und die daraus resultierende Glucosebereitstellung. Glucagon erzielt also die genau entgegengesetzte Wirkung von Insulin.
Insulin und Glukagon sind Beispiele für antagonistische Hormone, die gegensätzliche Wirkung haben, aber dadurch das physiologische Gleichgewicht einer oder mehrerer Körperfunktionen regulieren.
-
Insulin und Glucagon als Beispiel antagonistisch wirkender Hormone
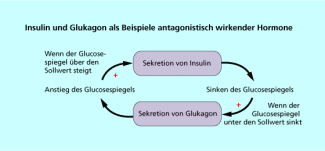
Adrenalin und Noradrenalin sind Botenstoffe des Nebennierenmarkes und werden aus Thyrosin gebildet. Adrenalin und Noradrenalin sind auch „Stresshormone“ und wichtige Überträgerstoffe im Nervensystem, dessen Aufgabe es ursprünglich war, den Körper zu Kampf oder Flucht zu befähigen. Sie besitzen ein breites Wirkungsspektrum.
Adrenalin wird ausgeschüttet bei: Körperlicher und seelischer Belastung, Infektionen, Verletzungen und niedrigem Blutzuckerspiegel (Hypoglykämie). Es erfüllt folgende Aufgaben:
| Es beschleunigt den Puls und die Pumpkraft des Herzens. | |
| Es steigert den Blutdruck durch Verengung der Blutgefäße. | |
| Es senkt die Darmtätigkeit. | |
| Es erweitert die Bronchien und die Pupillen. | |
| Es fördert den Sauerstoffverbrauch des Körpers. | |
| Es stellt Energien bereit, indem Fett- und Zuckervorräte des Körpers aus ihren Speichern gelöst werden. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel erhöht (entgegengesetzt zu Insulin). | |
| Es löst Unruhe und Angst aus. |
-
Synthese von Noradrenalin und Adrenalin
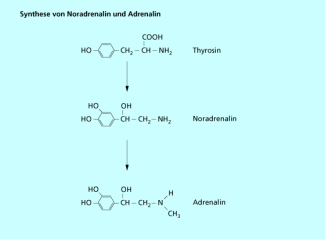
Noradrenalin unterscheidet sich chemisch nur gering von Adrenalin, seine Wirkungen sind jedoch zum Teil schwächer oder gar entgegengesetzt. Noradrenalin steigert zwar ebenfalls den Blutdruck, verbessert aber nicht die Pumpkraft des Herzens, senkt die Pulsfrequenz und hat kaum eine Wirkung auf den Blutzuckerspiegel. Beide Hormone vermindern die Magen-Darm-Tätigkeit, da Verdauung in Stress-Situationen unnötig Energie verbrauchen würde.
Obwohl die Zivilisation Kampf- und Fluchtreaktionen überflüssig macht, folgt der Körper immer noch den Wirkungen des Adrenalins und erhöht dadurch die Leistungsfähigkeit.
Bei Dauerstress stehen jedoch negative Effekte im Vordergrund: Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte oder Angstzustände. Deshalb ist ein Behandlungspunkt bei dauerhaftem (chronischem) Bluthochdruck: Stress abbauen!
-
Regulation und Wirkung von Glucocorticoiden
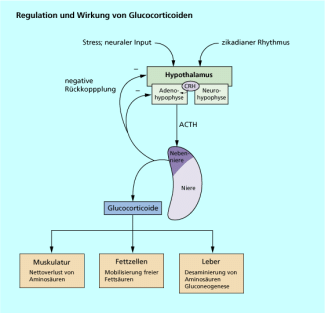
Glucacorticoide wie z. B. das Cortisol beeinflussen den Energiestoffwechsel. Sie fördern den Glykogenabbau in der Leber und die Synthese von Glucose aus Nicht-Kohlenhydraten wie z. B. aus Proteinen, wenn Glucosevorräte nicht mehr mobilisiert werden können oder aufgebraucht sind. Glucocorticoide werden in der Nebennierenrinde gebildet. Sie wirken auch entzündungshemmend.
Beispiele für Wachstums- und Entwicklungshormone (morphogenetische Hormone) sind das Wachstumshormon Somatropin und die Geschlechtshormone (Testesteron, Progesteron, Östradiol).
Das Wachstumshormon (Somatropin, Growth-Hormon (GH)) wird in der Adenohypophyse (Vorderlappen der Hypophyse) gebildet und vorrangig im Tiefschlaf freigesetzt. Es beeinflusst das Gewebewachstum, vor allem das der Knochen und der Knorpel. Diese Wirkung ist auf das Jugendalter (etwa bis 18 Jahre) begrenzt. Unzureichende Produktion im Kindes- und Jugendalter hat Zwergenwuchs zur Folge. Das Wachstumshormon hat aber auch über das Jugendalter hinaus Einfluss auf den Stoffwechsel. Es hat anabolische (muskelbildende) Wirkung, hemmt die Insulinwirkung und vermindert demzufolge den Zuckerabbau. Auch auf Haut und Gehirn sind positive Wirkungen nachgewiesen. Im Jugendalter ausreichend vorhanden, nimmt die Produktion des Wachstumshormons mit zunehmendem Alter ab. Die Folgen bei Mangel an GH reichen von Fettpolsterbildung und Cholesterinwerterhöhung bis Leistungsabnahme, Schwächung von Immun- und Blutsystem und Beeinträchtigungen der Gehirnfunktion - das Auftreten der typischen Alterungserscheinungen.
-
Regulation und Wirkung von Insulin und Glucagon
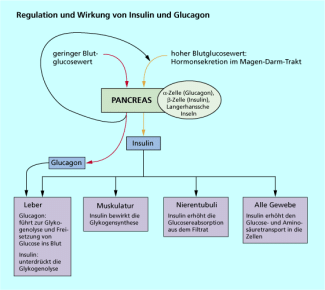
-
Wirkung des Wachstumshormons
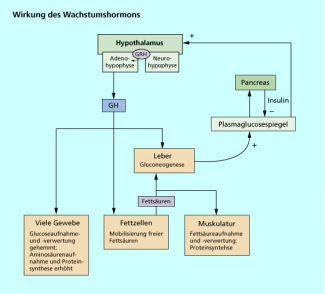
Geschlechtshormone (Sexualhormone) werden aus Cholesterin in den Keimdrüsen und z. T. in der Nebennierenrinde hergestellt und sind chemisch sehr ähnlich. Sie beeinflussen die geschlechtliche Entwicklung, den Körperbau, verschiedene Stoffwechselprozesse, die Emotionen und Motivationen und das Verhalten von Menschen und Tieren.
Die Synthese der Sexualhormone wird durch Hormone der Hypophyse (Adenohypophyse) stimuliert.
Männliche Sexualhormone, die Androgene (z. B. Testosteron) werden hauptsächlich in den Interstitiellen (embryonale Zellen, die noch nicht differenziert sind) oder den leydigschen Zwischenzellen, die zwischen den Samenkanälchen der Hoden liegen, gebildet. Das Testosteron löst während der Pubertät die Reifung des Hodengewebes und die Bildung von Spermien aus. Es hat Einfluss auf die Ausbildung sekundärer Geschlechtsmerkmale, auf das Wachstum der Muskulatur und das Verhalten.
In der Embryonal- und Kindheitsentwicklung des Menschen und vieler Wirbeltiere werden durch Testosteron und seine Vorstufen die primären Geschlechtsmerkmale sowie die Entwicklung der Sexualzentren im Gehirn stimuliert. Testosteron wird auch bei Frauen und Mädchen in der Nebennierenrinde gebildet.
-
Chemische Struktur und Synthese der Sexualhormone Progesteron, Testosteron und Östradiol
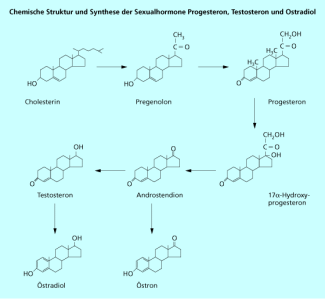
-
Wirkung und Regulation des Testosterons
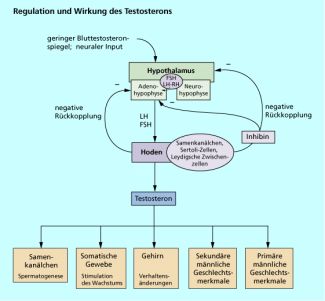
Weibliche Sexualhormone (Follikelhormon und Gelbkörperhormon) beeinflussen sich wechselseitig und auch ihre Synthese wird durch die Hypophyse gesteuert. Das Östradiol (früher Follikelhormon) wirkt in der Embryonal- und Kindheitsentwicklung auf die Ausbildung weiblicher Geschlechtsmerkmale und die Entwicklung der zyklischen Sexualzentren im Gehirn. Während der Pubertät und im Erwachsenenalter lösen sie den weiblichen Genitalzyklus aus. Reift (in der Regel alle 28 Tage) im weiblichen Eierstock durch Hormone angeregt eine Eizelle heran, bildet sich als Hülle ein flüssigkeitsgefülltes Bläschen - der sogenannte Follikel. Dieses Bläschen übernimmt die Funktion einer Hormondrüse und produziert nun Östradiol, welches die Gebärmutter informiert, sich durch die Bildung einer gut durchbluteten Wand auf die Einnistung und längerfristige Ernährung eines Embryos vorzubereiten.
Zirka 13 Tage später platzt der Follikel, gibt die Eizelle in den Eileiter frei und beginnt sofort sich mit Zellen zu füllen, die eine gelbliche Flüssigkeit enthalten (Gelbkörper). Dieser Prozess entspricht wieder der Umwandlung des Bläschens in eine Hormondrüse. Bei einer Befruchtung der Eizelle produziert diese nun das Hormon Progesteron, welches die begonnene Tätigkeit des Östradiol fortsetzt und die Gebärmutter weiter animiert, eine gut durchblutete Hülle vorzubereiten. Die Durchblutung wird weiterhin erhöht und ein Zusammenziehen der Gebärmutter verhindert. Bis zum 4. Schwangerschaftsmonat übernimmt der Gelbkörper die Steuerzentrale der Gebärmutter. Gleichzeitig verhindert Progesteron nun das Reifen anderer Eizellen und bereitet durch Auflockern des Bindegewebes, Erweichen des Beckenknochengewebes und Anregen entspannender Gefühle bereits die Geburt vor.
Bei Nichtbefruchtung wird der Aufbau der nun funktionslosen Gebärmutterschleimhaut nicht weiter veranlasst und sie wird abgestoßen (Menstruation).
-
Anatomische und physiologische Veränderungen während des Menstruationszyklus