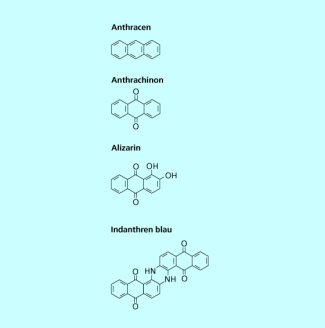Synthetische Farbstoffe
Als synthetische Farbstoffe werden die Farbstoffe bezeichnet, die industriell hergestellt werden. Der allergrößte Teil der synthetischen Farbstoffe ist von der chemischen Industrie neu entwickelt worden, aber auch die natürlichen Farbstoffe Indigo und Alizarin werden aus Kostengründen mittlerweile industriell hergestellt.
Chemisch betrachtet lassen sich die synthetischen Farbstoffe in mehrere Gruppen unterteilen. Drei wichtige Gruppen sind die Azofarbstoffe, die Triphenylmethanfarbstoffe und die Anthrachinonfarbstoffe.
Unter synthetischen Farbstoffen versteht man diejenigen Farbstoffe, die industriell hergestellt werden. Der erste synthetische Farbstoff war Mauvein, er wurde 1856 von William H. PERKIN entdeckt. An der Grenze zwischen den natürlichen und den synthetischen Farbstoffen stehen Indigo und Alizarin: bei ihnen handelt es sich um natürliche Farbstoffe, die heute jedoch synthetisch hergestellt werden, weil dies weniger kostet.
Chemisch betrachtet lassen sich die synthetischen Farbstoffe in mehrere Gruppen unterteilen, von denen im folgenden die Azofarbstoffe, die Triarylmethanfarbstoffe und die Anthrachinonfarbstoffe näher besprochen werden sollen.
Azofarbstoffe
Die größte Farbstoffgruppe sind die Azofarbstoffe, deren gemeinsames Strukturmerkmal die Azogruppe ist. Sie wurden bereits im 19. Jahrhundert hergestellt. Damals verwendete man das aus Steinkohlenteer gewonnene Anilin als Ausgangskomponente. Dieses wurde zuerst der Diazotierung und anschließend der Azokupplung unterworfen.
Bei der Diazotierung wird ein aromatisches Amin wie Anilin mit Natriumnitrit und Salzsäure umgesetzt, wobei ein Diazoniumsalz entsteht.
![]()
-
Mauvein
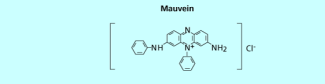
Bei der Azokupplung handelt es sich um eine elektrophile Substitution am Aromaten, bei der das positiv geladene Diazonium-Kation als Elektrophil fungiert. Die Kupplungskomponente, an die es gebunden wird, muss einen Substituenten mit + M-Effekt tragen, damit die para-Stellung ausreichend aktiviert ist und der elektrophile Angriff an dieser Position erfolgt.
![]()
Durch weitere, unterschiedliche Substituenten an den beiden Aromaten lässt sich eine Vielzahl von verschiedenen Azofarbstoffen herstellen (Bild 3). Durch Protonierung eines Azostickstoffs bei saurem pH-Wert verändert sich das mesomere System und damit die Farbigkeit, sodass sich viele Azofarbstoffe als Indikatoren eignen.
Das wichtigste Anwendungsgebiet dieser Farbstoffe ist die Textilfärbung.
-
Beispiele für Azofarbstoffe
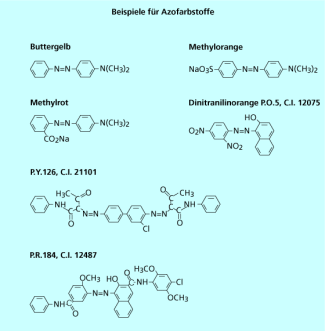
Triphenylmethanfarbstoffe
Eine weitere Farbstoffgruppe sind die Triphenylmethanfarbstoffe (Triarylmethanfarbstoffe). Als gemeinsames Strukturelement besitzen sie den Triphenylmethan-Grundkörper. In para- oder ortho-Stellung tragen die Phenylringe mindestens einen aktivierenden Substituenten z. B. Amino-Gruppen.
Die bekanntesten Vertreter dieser Farbstoffklasse sind Phenolphthalein, Kristallviolett und Malachitgrün (Bild 4).
Phenolphthalein wird als pH-Indikator verwendet, da seine Farbigkeit pH-abhängig ist.
![]()
Bei der Leukoform (der farblosen Form) des Moleküls handelt es sich um ein Polyen, bei dem lediglich 8 Atome mit 4 am mesomeren System beteiligt sind. Daher ist es farblos. Durch Deprotonierung entsteht ein sehr viel ausgedehnteres mesomeren System. Nun sind 11 Atome mit 6 an der Mesomerie beteiligt, was dazu führt, dass das Dianion des Phenolphthaleins tiefrosa gefärbt erscheint.
Da die Triarylfarbstoffe nicht waschecht sind, haben sie in der Textilfärbung keine Bedeutung. Sie werden als Lebensmittelfarben, in der Kosmetik, in der Papier- und Druckindustrie eingesetzt.
-
Kristallviolett und Malachitgrün sind wichtige Triarylmethanfarbstoffe
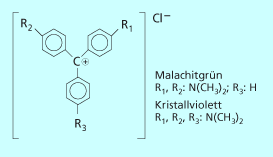
Anthrachinonfarbstoffe
Ausgehend von Anthrachinon als Grundkörper bilden die Anthrachinonfarbstoffe eine weitere wichtige Gruppe der Farbstoffe (Bild 5).
![]()
Durch Einführung von Hydroxy- und Amino-Gruppen als Substituenten am Aromaten lässt sich ähnlich wie bei den Azofarbstoffen fast jede beliebige Farbe erzeugen.
Für die Synthese von Anthrachinon gibt es zwei Möglichkeiten
- Oxidation von Anthracen zu Anthrachinon
- Elektrophile Substitution von Phthalsäureanhydrid an Benzen, wobei als Katalysator verwendet wird (Friedel-Crafts-Reaktion)
Im weiteren Verlauf der Farbstoffsynthese wird Anthrachinon sulfoniert, da sich die Sulfonsäuregruppe leicht gegen den gewünschten Substituenten austauschen lässt. Auf diese Weise lässt sich aus Anthrachinon z. B. Alizarin in zwei Schritten herstellen.
Anthracen, das als Ausgangsstoff zur Synthese eingesetzt wird, ist im Steinkohleteer enthalten, der bei der Kohleentgasung (Verkokung) als Nebenprodukt anfällt. Die Anthrachinonfarbstoffe werden daher auch als Teerfarbstoffe bezeichnet.
Ein besonders wasch- und lichtechter Anthrachinonfarbstoff ist das Indanthrenblau. Es besteht formal aus zwei Molekülen Anthrachinon, die über Amino-Gruppen miteinander verbunden sind. Hergestellt wird es durch Verschmelzen von Diaminoanthrachinon mit Kaliumhydroxid und Kaliumnitrat.
Der Name Indanthren wird heute noch als Warenzeichen für besonders hochwertige Farbstoffe verwendet, die aber mit dem ursprünglichen Indanthrenblau nur noch den Anthrachinon-Grundkörper gemeinsam haben. Bei diesen Indanthren-Farbstoffen handelt es sich um komplexe Ringsysteme, die meist durch Kondensation von Anthrachinon-Derivaten hergestellt werden.
-
Anthrachinon als Grundkörper für verschiedene Anthrachinonfarbstoffe