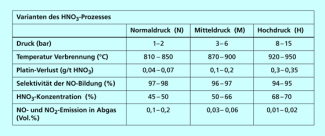Technische Herstellung von Salpetersäure
Salpetersäure ist eine der drei wichtigsten Säuren in der chemischen Industrie. Sie wird hauptsächlich zur Herstellung von Stickstoffdüngemitteln verwendet. Etwa 10-15 % nutzt man zur Herstellung von organischen Verbindungen, die zur Gewinnung von Fasern und Kunststoffen dienen. Weitere Anwendungen sind die Herstellung von Sprengstoffen und als Ätzmittel für Metalle.
Salpetersäure wird nach dem OSTWALD-Verfahren in drei Teilschritten hergestellt. Zuerst wird Ammoniak mit Luft zu Stickstoffmonooxid oxidiert, das anschließend mit Luft zu Stickstoffdioxid reagiert. Zum Schluss wird das Stickstoffdioxid mit Wasser zu Salpetersäure umgesetzt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ sich Salpetersäure nur durch Umsetzung von dem in Chile vorkommenden Rohstoff Natriumnitrat (Chilesalpeter) mit Schwefelsäure herstellen.
In den Jahren 1901/1902 untersuchte WILHELM OSTWALD. der 1909 den Nobelpreis erhielt, erstmalig systematisch die Oxidation von Ammoniak mit Luftsauerstoff und entwickelte dabei das nach ihm benannte Verfahren zur Salpetersäureherstellung.
Bereits im Jahre 1908 produzierte die erste industrielle Anlage in Bochum auf diesem Wege täglich etwa 3 Tonnen Salpetersäure. Eine Ausweitung der Salpetersäureproduktion nach dem OSTWALD-Verfahren wurde in Deutschland notwendig, als im 1. Weltkrieg zum einen der Bedarf an Salpetersäure zur Explosivstoffherstellung stark zunahm und zum anderen die Einfuhr von Chilesalpeter durch die Alliierten verhindert wurde. Wesentliche Voraussetzung für die Salpetersäureherstellung war jedoch, dass über das HABER-BOSCH-Verfahren große Mengen billiger Ammoniak zugänglich waren. Damit wurde dann auch die Salpetersäuregewinnung aus Chilesalpeter wirtschaftlich uninteressant, sodass heute praktisch nur nach dem OSTWALD-Verfahren gearbeitet wird.
OSTWALD-Verfahren
Im OSTWALD-Verfahren wird Salpetersäure kontinuierlich in drei Teilschritten hergestellt.
1. Oxidation von Ammoniak
Ammoniak wird im Kontaktofen mit Luftsauerstoff oxidiert, wobei verschiedene Stickstoffoxide und elementarer Stickstoff entstehen können.
Erwünscht ist die Bildung von Stickstoffmonooxid (Gleichung 1), thermodynamisch gesehen sind aber die beiden anderen Reaktionen günstiger, weil bei ihnen mehr Energie freigesetzt wird. Damit Reaktion 1 bevorzugt abläuft, werden Platinnetze als Katalysator verwendet, wodurch nur diese Reaktion beschleunigt wird, und die Reaktionszeit ist mit 0,001 s sehr kurz, sodass die langsamer ablaufenden Nebenreaktionen weitgehend vermieden werden. Die Reaktionstemperatur liegt bei 820-950 °C, was dazu führt, dass die am wenigsten exotherme Reaktionen 1 gegenüber den anderen Reaktionen bevorzugt abläuft. Nach der Reaktion muss das gebildete Stickstoffmonooxid sofort abgekühlt werden, weil es sonst in die Elemente zerfällt. Unter diesen Bedingungen entstehen 94-98 % Stickstoffmonooxid, 2-6 % elementarer Stickstoff (Gleichung 3) und praktisch kein Distickstoffmonooxid (Gleichung 2).
2. Oxidation von Stickstoffmonooxid
Nach Abkühlung der Gase auf Raumtemperatur wird Stickstoffmonooxid im Oxidationsturm mit Luftsauerstoff zu Stickstoffdioxid weiteroxidiert.
Diese Gleichgewichtsreaktion ist exotherm und verläuft unter Volumenabnahme, sie wird daher gemäß dem Prinzip von LE CHATELIER durch niedrige Temperaturen, d. h. durch Kühlung des Reaktors, und durch höhere Drücke begünstigt.
3. Umsetzung von Stickstoffdioxid mit Wasser
In einer Absorptionskolonne wird Stickstoffdioxid im Gegenstrom mit Wasser umgesetzt, wobei eine Disproportionierung zu Salpetersäure und Stickstoffmonooxid stattfindet.
Das bei der Reaktion als Nebenprodukt gebildete Stickstoffmonooxid reagiert sofort mit überschüssigem Sauerstoff zu Stickstoffdioxid. Dieses wird wieder mit Wasser zu Salpetersäure umgesetzt. Auch diese Reaktion wird durch niedrige Temperaturen und höhere Drücke begünstigt, weil sie exotherm ist und das Gesamtvolumen der Produkte geringer ist als das der Edukte.
Die Salpetersäure, die hierbei entsteht, hat eine Konzentration von 50-69 %, was für die meisten Anwendungen ausreichend ist. 69%ige Salpetersäure-Lösung (konzentrierte Salpetersäure) ist ein azeotropes Gemisch, das bei 122 °C siedet, das Wasser kann daher nicht destillativ entfernt werden. Um höherkonzentrierte Salpetersäure-Lösungen zu erhalten, destilliert man konzentrierte Salpetersäure in Anwesenheit von wasserentziehenden Stoffen wie konzentrierter Schwefelsäure.
Weil es sich bei der Reaktion von Stickstoffdioxid mit Wasser um eine Disproportionierung handelt, bei der außer Salpetersäure immer Stickstoffmonooxid entsteht, ist kein vollständiger Umsatz der Stickoxide erreichbar. Das Abgas enthält am Ende des Absorptionsturms noch ca. 0,02-0,05 % Stickstoffoxide, sowohl Stickstoffmonooxid als auch Stickstoffdioxid (abgekürzt ). Diese sind umweltschädlich und werden daher bei der Abgasreinigung (s. u.) entfernt.
Varianten der technischen Durchführung
Salpetersäureanlagen können unter verschiedenen Druck-Bedingungen arbeiten (Bild 4), man unterscheidet hierbei Normaldruck (1-2 bar), Mitteldruck (2-6 bar) und Hochdruck (8-15 bar).
Für die erste Prozessstufe, die Verbrennung von Ammoniak zu Stickstoffmonooxid ist geringer Druck vorteilhaft, da die Platinverluste geringer sind und auch der Anteil der unerwünschten Nebenreaktion, nämlich die Verbrennung des Ammoniaks zu Stickstoff (Gleichung 3), geringer ist. Damit werden höhere Salpetersäureausbeuten erhalten.
Für die zweite und die dritte Prozessstufe, die Weiteroxidation zu Stickstoffdioxid und die Umsetzung zu Salpetersäure ist hingegen nach dem Prinzip des kleinsten Zwanges von LE CHATELIER die Anwendung höherer Drücke vorteilhaft, da höhere Salpetersäurekonzentrationen erreicht werden und der Restgehalt an Stickoxiden im Abgas geringer ist. Allerdings fallen zusätzlich Kosten für die Kompression an.
Die Wahl des Anlagentyps hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Es gibt Anlagen, die in allen drei Prozessstufen unter Mitteldruck bzw. Hochdruck arbeiten. Andererseits kann es auch vorteilhaft sein, in der ersten Stufe mit Mitteldruck zu arbeiten und die Gase anschließend auf einen höheren Druck zu verdichten, da bei der Absorption von Stickstoffdioxid in Wasser (dritte Prozessstufe) unter Hochdruck die Emissionen an Stickoxiden so gering sind, dass eine Reinigung des Abgases entfallen kann.
Abgasreinigung bei der Salpetersäureherstellung
Um die Umwelt nicht zu stark zu belasten, müssen die Abgase bei der Salpetersäureherstellung gereinigt werden. Die Stickstoffoxide Stickstoffmonooxid und Stickstoffdioxid reagieren in der Atmosphäre mit Wasser zu Salpetriger Säure beziehungsweise zu Salpetersäure und tragen zum Sauren Regen bei. Um die Freisetzung der Stickstoffoxide zu verhindern, wurden „DeNOx-Anlagen“ in Betrieb genommen. Darin reagieren die Stickstoffoxide an einem Katalysator mit zugesetztem Ammoniak. Bei einer Temperatur von etwa 320 bis 400°C reagiert der Ammoniak selektiv mit den Stickstoffoxiden zu Stickstoff und Wasser.
Durch dieses Verfahren kann die Stickstoffoxidemission in den Industrieanlagen um 80% gesenkt werden.
Diese sogenannte „Entstickung“ muss nicht nur bei den Abgasen der Salpetersäureherstellung durchgeführt werden, sondern auch bei Heizkraftwerken, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, und bei Müllverbrennungsanlagen, weil hier ebenfalls umweltschädliche Stickstoffoxide entstehen.
-
Varianten der Salpetersäureherstellung bei unterschiedlichem Druck