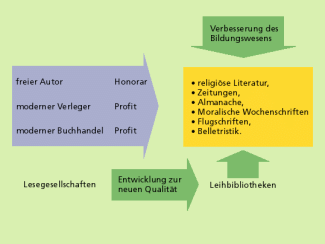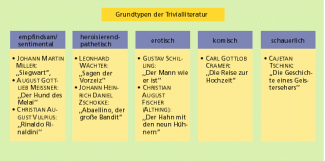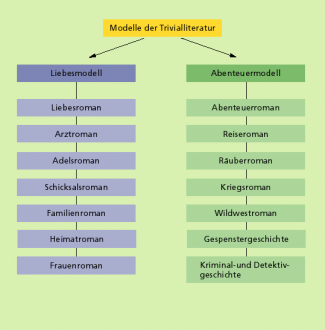Trivialliteratur
Trivialliteratur will auf leichte, lockere Weise unterhalten. Sie ist sprachlich durch einfache Strukturen gekennzeichnet, oft sehr bildhaft. Die Handlungsfiguren entsprechen typisch trivialen Mustern.
Die Trivialliteratur ist im 18. Jahrhundert während der Aufklärung entstanden. Sie bediente sich weniger Sujets und trat als Liebesgeschichte, Historie, Räuberpistole, Gruselgeschichte, Kriegsgeschichte in Erscheinung. Verbreitet wird die Trivialliteratur heute zumeist über das Groschenheft. Triviale Varianten des Films sind u.a. die soap operas.
Begriff der Trivialliteratur
Als Trivialliteratur wird eine besondere Spielart der Literatur bezeichnet, die von den Normen der „hohen“ bzw. „gehobenen“ Literatur abweicht. Sie will auf leichte, lockere Weise unterhalten.
Der Begriff leitet sich von lat. trivialis = allgemein bekannt, gewöhnlich ab. Andere Bezeichnungen für die Trivialliteratur sind:
- Kolportageliteratur,
- Schemaliteratur,
- Unterhaltungsliteratur.
Der Begriff Unterhaltungsliteratur bezeichnet das Phänomen jedoch sehr unpräzise.
Die Trivialliteratur setzte etwa zeitgleich mit der Aufklärung ein.
Merkmale der Trivialliteratur
- einfache sprachliche Strukturen,
- einfache inhaltliche Strukturen,
- ausschließlich auf Unterhaltung orientiert,
- Ansprechen der Gefühle des Lesers,
- bildhafte Sprache, die zuweilen klischeehaft wirkt,
- Handlungsfiguren, die ein- und demselben Raster entsprechen,
- Handlung, die nach vorgefertigten Mustern gefügt ist,
- wenige Themen: Liebe, Abenteuer, Kriminalfall, Schauergeschichte.
Ein weiteres Merkmal der Trivialliteratur ist, dass es sich um Massenliteratur in dreieierlei Hinsicht handelt:
- wird massenhaft gedruckt,
- wird massenhaft vertrieben,
- wird massenhaft gelesen.
Voraussetzungen für das Entstehen von Trivialliteratur
- die Existenz eines merkantilistischen Prinzipien folgenden Buchmarktes,
- das Vorhandensein eines Lesepublikums,
- die drucktechnischen Veränderungen der Produktion von Literatur,
- die Entstehung von Leihbüchereien,
- die Rezeption und öffentliche Kritik.
Buchmarkt und Trivialliteratur
Seit 1750 wuchs das Schrifttum in Deutschland enorm an: Ein Buchmarkt entstand, auf dem deutsche Titel vorherrschten. Buchhändler liehen erstmals Bücher aus, sodass sie von mehreren Kunden gelesen werden konnten.
Auch Taschenbücher sind bereits für das 18. Jahrhundert nachweisbar. Und seit den Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts gab es kleinformatige, broschierte und preiswerte Buchausgaben. Es existierten sogar Buchreihen.
Zwar veränderte sich die Rolle des Schriftstellers in jener Zeit, jedoch wurde er für seine Arbeit sehr dürftig bezahlt (pro Bogen bekam er nur 5 bis 7 Taler, ein Maßanzug kostete jedoch 20 Taler). Auch war seine Arbeit urheberrechtlich nicht geschützt. Jeder Verleger konnte seine Texte veröffentlichen.
Erst am 11. Juni 1837 wurde mit dem „Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und Kunst in Nachdruck und Nachbildung“ in einem deutschen Staat ein modernes Urheberrecht in Kraft gesetzt. Damit wurden sogenannte Raubdrucke verboten, und der Autor bekam ein gerechtes Honorar für seine Arbeit.
Sujets der Trivialliteratur
Die Sujets der Trivialliteratur blieben auf wenige Themen beschränkt.
Der expandierende Buchmarkt des 18. Jahrhunderts folgte dem Unterhaltungsbedürfnis seines Publikums. Dieser Trend ist vor allem seit der Periode der Empfindsamkeit zu beobachten. „Empfindsam“ bedeutete in dieser Phase, auch besonders „tugendhaft“ bzw. „sittsam“ zu sein. Deshalb nahm man sich eben solcher Sujets an. Die einfache Struktur dieser Literatur war gekennzeichnet durch den tugendhaften (guten) positiven Helden und seinen lasterhaften (bösen) negativen Gegenspieler. Erfolgsbüchern wie „Yoricks empfindsame Reise“ von LAURENCE STERNE (1768) und anderen folgten oft rasch geschriebene Parodien und Nachahmungen, die darauf abzielten, den Leser intellektuell zu entlasten. Trivialliteratur war also „schnell produzierte Literatur“, deren Helden Stereotypen darstellten. Erfolgreich getestete literarische Muster wurden unter den Bedingungen des wirtschaftlichen Gewinns kopiert. So gab es nach JOHANN WOLFGANG VON GOETHEs Briefroman „Die Leiden des jungen Werthers“ (Leipzig 1774) ein regelrechtes „Wertherfieber":
- „Siegwart“ (1776) von JOHANN MARTIN MILLER (1750–1814)
- „Siegwart und Mariana“ (1781), anonym
- „Siegwart, oder der auf dem Grabe seiner geliebten jämmerlich verfrohrene Kapuciner“ (1777), Parodie von FRIEDRICH BERNRITTER
- „Siegwart der Zweyte. Eine rührende Geschichte“ (1780), moraldidaktische Variante
- „Die Freuden des jungen Werthers“ von FRIEDRICH NICOLAI (1733–1811), Parodie.
In „Die Freuden des jungen Werthers“ wird der „Werther“ so umgeschrieben, dass der Held Lotte heiratet, mit ihr acht Kinder zeugt und absolut in der Idylle lebt. Indem NICOLAIs „Werther“ des Konfliktes beraubt ist, wird er eine bissige Satire auf die Trivialisierung des Stoffes.
„Die neuen Leiden des jungen W.“ von ULRICH PLENZDORFF (geb. 1934) ist eine späte Reflexion auf GOETHEs Werk.
Ausgesprochen triviale Literatur wie CHRISTIAN AUGUST VULPIUS' (1762–1827, Schwager GOETHEs) überaus erfolgreicher Räuberroman „Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann“ (1799), in dem Motive aus FRIEDRICH VON SCHILLERs „Räubern“ und GOETHEs „Goetz von Berlichingen“ trivialisiert wurden, fand ebenfalls triviale Nachahmer, u. a. „Antonia della Roccini, die Seeräuber-Königin“ von ERNST DANIEL BORNSCHEIN (1774–1838), ein quasi Gegenstück zum „Rinaldini“, und „Marino Marinelli, der kühne Seeräuber“ (1890) von GEORG F. BORN. Aber auch VULPIUS selbst, stets in Geldnöten, versuchte an den Erfolg seines „Rinaldo Rinaldini“ anzuknüpfen. „Ferrando Ferrandino“ und „Orlando Orlandini“ wurden jedoch nicht mehr die „Verkaufshits“.
Verbreitung der Trivialliteratur
Verbreitung fand die Trivialliteratur
- neben der Buchform
- in Kalenderblättern und
- als Fortsetzungsroman in Unterhaltungs- und Familienzeitungen („Die Gartenlaube“),
- in Almanachen und Taschenbüchern.
Im 19. Jahrhundert bekamen die nun entstehenden Zeitungen und Zeitschriften eine neue Funktion als Sprachrohre für einzelne Berufsgruppen bzw. politische Gruppierungen. Nun wurde die Trivialliteratur auch mittels der Kolportage verbreitet.
Kolportageliteratur
Die Kolportage ist eine traditionelle Form des Buchmarktes. Dabei preist der Buchverkäufer in Wirtshäusern, auf öffentlichen Plätzen bzw. in den Wohnungen potentieller Leser seine Bücher an.
Einer der ersten Produzenten der Kolportageliteratur war JOHANN JOSEPH BREYER, der 1851–1852 den Roman „Adelmar von Perlstein ...“ von GUIDO WALDNER in acht Lieferungen veröffentlichte.
Um auch die nicht vermögenden Leser als Kunden zu gewinnen, entschloss man sich, die Kolportageromane in Lieferungen mit einem Heftumfang von 24, 48 oder 64 Seiten aufzuteilen, die von Kolporteuren vertrieben wurden. Eine Lieferung kostete nach ihrem Umfang etwa 10, 20 oder 30 Pfennige.
Vertreter der Trivialliteratur
- AUGUST FRIEDRICH VON KOTZEBUE (1761–1819) und
- AUGUST WILHELM IFFLAND (1759–1814).
Manche ihrer Stücke wurden häufiger gespielt als die GOETHEs, SCHILLERs oder SHAKESPEAREs. GOETHE selbst ließ als Theaterdirektor 90 von ca. 230 Dramen von KOTZEBUE aufführen. Ein bekanntes Werk der Trivialliteratur von KOTZEBUE ist das Lustspiel „Die deutschen Kleinstädter" von 1801 (siehe PDF "August von Kotzebue - Die deutschen Kleinstädter").
Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte einen Boom des historischen Romans. Etwa 1/3 der belletristischen Buchproduktion widmete sich allein im Jahre 1825 dem historischen Sujet. Von diesen ahmte ein Großteil bereits erfolgreiche Themenkreise nach.
Im 19. Jahrhundert galt das Werk KARL MAYs (1842–1912) als trivial. Bereits die Erzählschlüsse einiger seiner Werke weisen MAY als Trivialautoren aus. Hier wird abgehoben auf die edle Gesinnung, reduziert auf das bloße Abenteuer, orientiert lediglich auf das Gefühl des Lesers:
„Dann nahmen wir die Gefangenen zwischen uns und brachen auf, um der Stadt Palmar und neuen Ereignissen entgegenzureiten.“
(KARL MAY: Am Rio de la Plata)„Es galt, in dieser Nacht einen tüchtigen
Ritt zu tun, und da war es gut, daß Sam die Gegend leidlich kannte. Er richtete sich auf seiner
Mary im Sattel auf, erhob die Faust, nach rückwärts drohend, und sagte:
»Jetzt stecken sie da droben die Köpfe und die Schädel zusammen, um zu beraten, wie sie uns
wieder in ihre Vorderfüße bekommen. Sollen sich wundern! Sam Hawkens ist nicht wieder so
dumm, in einem Loche stecken zu bleiben, aus welchem ihn ein Greenhorn herausziehen muß.Mich
fängt kein Kiowa wieder, wenn ich mich nicht irre!«“ (KARL MAY, Winnetou I, siehe PDF "Karl May – Winnetou I")„Wirst du den Feind erjagen? Wann sehe ich dich wieder, du lieber, lieber Winnetou?“
(KARL MAY: Winnetou II)„So waren sie, die uns erst nach dem Leben trachteten, durch innere Wandlung zu unsern Beschützern geworden und für uns in den Tod gegangen!“
(KARL MAY: Winnetou IV)„Dieser durfte unmöglich das großmütige Anerbieten ablehnen, und so flogen wir denn, beide gleich gut beritten und zunächst eine südliche Route einschlagend, in den frischen Morgen hinein. “ (KARL MAY: Satan und Ischariot I)
Auch EUGENIE MARLITT (1825–1887) und EMMY VON RODEN (1829–1885) waren, gerade beim Frauenpublikum, beliebte Autorinnen.
JOHANNA SPYRI (1827–1901) ist mit ihren „Heidi"-Geschichten die bekannteste Trivialautorin der Schweiz. Die Bände „Heidis Lehr- und Wanderjahre“ (1880) und „Heidi kann brauchen, was es gelernt hat“ (1881) wurden ungefähr 50 Millionen Mal verkauft und in 50 Sprachen übersetzt. SPYRIS Werk umfasst etwa 40 Titel, mit ihrem Namen verbindet man sie jedoch zumeist mit der „Heidi“-Figur. Außerdem ist der Stoff sowohl als Trick- als auch als Realfilm über 10-mal verfilmt worden.
Die bekannteste Trivialautorin des 20. Jahrhunderts war HEDWIG COURTHS-MAHLER (1867–1950). Mit über 200 Romanen und weit über 80 Millionen Gesamtauflage gehört sie zu den erfolgreichsten Autorinnen aller Zeiten.
Konservativ-nationalistische Literatur wirkt oft über weite Strecken trivial, da sie Klischees verwendet, die religiöses Pathos bewirken sollen. Der Krieg wird ästhetisiert, und die Bereitschaft zum Krieg wirkt wie eine Selbstopferung an einen kriegerischen Gott.
„Trotz und Demut, die Anmut des Jünglings, lagen wie ein Glanz über der Haltung des straffen Körpers, dem schlanken Kraftwuchs der Glieder, dem stolzen Nacken und der eigenwilligen Schönheit von Mund und Kinn. ... Mit einmal legte er mir den Arm um die Schulter und rückte das helle Schwert vor meine Augen: 'Das ist schön, mein Freund! Ja?' Etwas wie Ungeduld und Hunger riss an den Worten, und ich fühlte, wie sein heißes Herz den großen Kämpfen entgegenhoffte.“
(WALTER FLEX: „Der Wanderer zwischen beiden Welten“, 1917)
HEINZ G. KONSALIK (1921–1999), Verfasser von historischen Romanen und Kriegsromanen, ist einer der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg. 155 seiner Romane wurden in 42 Sprachen übersetzt.
Trivialliteratur in der DDR
Auch in der ehemaligen DDR gab es trivialliterarische Erscheinungen. Gerade die für diese Art Literatur typische „Schwarz-Weiß-Zeichnung“ der Figuren machte das triviale Element interessant für eine pauschale Gut-Böse-Ausrichtung der Figuren. Das in der DDR sehr bekannte Motto: „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“ barg eine Trivialisierung gesellschaftlicher Phänomene bereits in sich. Trivial wird Literatur, wenn beispielsweise ein schönes Äußeres auch auf die innere Schönheit der Figur schließen lässt, für edle Gesinnung das edle Antlitz steht. Die Forderung nach „einer einfachen Sprache, die auch der Arbeiter versteht“ und die nach dem positiven Helden in der Geschichte machte vor allem die historische Belletristik anfällig für triviale Elemente. Die Vereinfachung und Vergröberung des Geschichtsablaufes zugunsten einer „im Sinne der Arbeiterklasse“ positiven Umwertung geschichtlicher Prozesse führte dazu, dass der positive Held plebejischer bzw. proletarischer Abstammung war, der negative Gegenspieler jedoch dem Junkertum bzw. der Bourgeoisie anzugehören hatte. Beispiele für diese Geschichtssicht sind FRANK MANNs „Verrat am Roten Berg“, GERHARD HARKENTHALs „Hochgericht in Toulouse“ oder auch KÄTHE MIETHEs „Bark Magdalene“. Oft wird der Leser in das „Morgenrot“ entlassen, das die neue Zeit der Freiheit von Ausbeutung und Unterdrückung symbolisieren soll. Zuweilen wirkt der Erzählschluss formelhaft:
„Fossaloux sah sie an. Das Blut tropfte ihm von der Schläfe, sein Haar hing wirr ins Gesicht. Noch nie war er ihr so erschienen, so gequält, und doch voll trotzigen Mutes. Deshalb glaubte sie auch, ihn zu verstehen, als er jetzt sagte: 'Den Sturm haben andere entfesselt. Und der Tag wird kommen, da er sie hinwegfegt!'“
(GERHARD HARKENTHAL „Hochgericht in Toulouse“)
Groschenhefte
Das Groschenheft entstand um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. 1905 wurde Buffalo Bill, der Held des Wilden Westens, erstmals in Deutschland gedruckt. Jerry Cotton, John Sinclair und Perry Rhodan heißen die Helden heutiger Groschenromane. Sie stehen für Kriminalroman, Geisterjäger- und Science-Fiction-Literatur. „Chefarzt Dr. Holl“ oder „Der Bergdoktor“ sind Heftreihen aus dem „Arztmilieu“; „Rebecca“ ist eine Frauenroman-Serie. Den Groschenheften liegen die zwei Grundmodelle der Trivialliteratur zugrunde (Liebemodell, Abenteuermodell, siehe Bild 4).
In der DDR kursierten Heftreihen wie „Das Neue Abenteuer“, „Blaulicht“, „Roman-Zeitung“ usw. In ihnen kämpfte jedoch kein einzelner Held wie etwa Jerry Cottan gegen das Böse, sondern es wurden in sich abgeschlossene Erzählungen präsentiert. Eine Ausnahme bildete das Comic-Heft „Mosaik“, hier agierten zunächst die Digedags und später die Abrafaxe.
Trivialliteratur zeigt sich gerade in der Serie an der Autorenschaft. Da jede Woche eine Ausgabe fertig sein muss, werden mehrere Autoren am Schreibprozess mitwirken müssen. So sind derzeit 12 Autoren an dem Groschenheft-Projekt „Perry Rhodan“ beteiligt. Ähnliches lässt sich auch für die so genannten „soap operas“ des Fernsehens beobachten.
Suche nach passenden Schlagwörtern
- FRIEDRICH NICOLAI
- Sujets
- Rebecca
- AUGUST FRIEDRICH VON KOTZEBUE
- EMMY VON RODEN
- Aufklärung
- HEINZ G. KONSALIK
- Unterhaltungsliteratur
- Wertherfieber
- CHRISTIAN AUGUST VULPIUS
- Urheberrecht
- Winnetou
- Taschenbuch
- Empfindsamkeit
- FRIEDRICH BERNRITTER
- ULRICH PLENZDORFF
- KÄTHE MIETHE
- Abrafaxe
- Adelmar von Perlstein...
- Gruselgeschichte
- Roman-Zeitung
- ERNST DANIEL BORNSCHEIN
- HEDWIG COURTHS-MAHLER
- GEORG F. BORN
- Buchmarkt
- Fortsetzungsroman
- Rinaldo Rinaldini
- Familienzeitung
- Unterhaltungszeitung
- Das Neue Abenteuer
- Historie
- John Sinclair
- FRANK MANN
- EUGENIE MARLITT
- Schemaliteratur
- AUGUST WILHELM IFFLAND
- Die deutschen Kleinstädter
- DDR
- Kriegsgeschichte
- Chefarzt Dr. Holl
- Comic-Heft Mosaik
- JOHANN JOSEPH BREYER
- Liebesgeschichte
- Massenliteratur
- Heidi
- Räuberpistole
- GERHARD HARKENTHAL
- Groschenheft
- Buchreihe
- KARL MAY
- Goetz von Berlichingen
- soap opera
- JOHANNA SPYRI
- Kalenderblätter
- Die neuen Leiden des jungen W.