Dach
Das Dach gilt als funktionell bedingter oberer Raumabschluss eines Gebäudes, wurde aber darüber hinaus schon immer zur Formung des Baus benutzt. Abwechslungsreiche „Dachlandschaften“ entstanden bei den großen Kathedralen, bei historischen ostasiatischen Bauten, aber auch in den Altstädten Mitteleuropas. Seit dem vorigen Jahrhundert wird das Dach verstärkt zum Form-Ausdruck eines Baus und zu seiner Symbolisierung eingesetzt.
Ein Dach bildet den oberen Abschluss eines Gebäudes, um es vor Witterungseinflüssen, z. B. vor Regen, Schnee, Wind, Kälte und Hitze zu schützen. Es dient aber auch als wichtiges Gestaltungsmittel für die Gesamtansicht des Gebäudes. Dächer bestehen aus Dachkonstruktion und Dacheindeckung. Die Dachkonstruktion muss Schnee- und Windlasten standhalten und ist gleichzeitig das Traggerüst für die Dacheindeckung.
Zu den bekanntesten Dachformen zählen Pult-, Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdach. Andere Dachformen sind z. B. das Mansard-, Zelt-, Säge- und das Flachdach. Dächer werden nach ihrem Querschnitt in Sattel-, Mansard- und Pultdach und nach ihrem Längsschnitt in Giebel-, Krüppelwalm-, Walm- und Zeltdach unterteilt. Dächer mit einer Neigung von unter 5 ° werden als Flachdächer, von 5 bis 40 ° als mäßig steile Dächer und mit über 40 ° als Steildächer bezeichnet.
Dachformen
Ein Pultdach wird meist für nachträgliche Anbauten an eine schon vorhandene Gebäudewand verwendet und hat nur eine Dachfläche. Die Dachfläche befindet sich meist auf der Wetterseite.
-
Pultdach
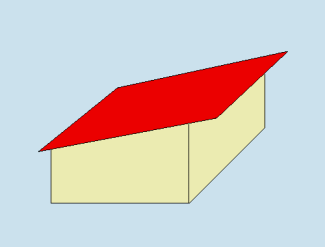
Beim Satteldach – die am häufigsten verwendete und wirtschaftlichste Dachform – gehen die Giebelwände bis zu den Dachflächen.
-
Satteldach
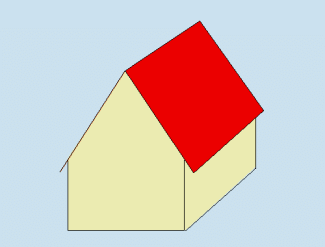
Ein Walmdach entsteht aus einem Satteldach, nur dass sich an den Giebelwänden ebenfalls Dachflächen (Walme) befinden. Es gehört zu den ältesten Dachformen.
-
Walmdach
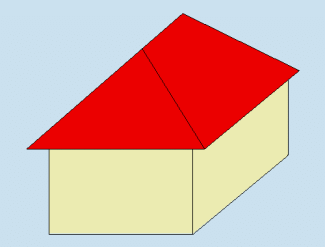
Ein Krüppelwalmdach ist eine Kombination aus Sattel- und Walmdach. Die Walmflächen zeichnen sich durch eine geringere Höhe als die Hauptdachflächen aus.
-
Krüppelwalmdach
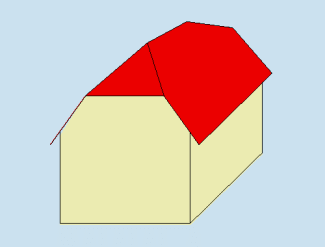
Ein Mansarddach hat gebrochene Dachflächen, dabei sind die unteren Dachflächen steiler als die oberen. Ein Mansarddach bietet eine besonders große, nutzbare Dachfläche, da die Schrägen wesentlich kürzer und damit als Stellflächen im Wohnraum nutzbar sind.
-
Mansarde
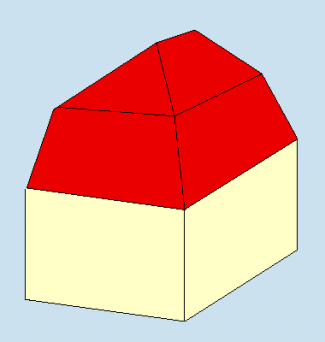
Ein Zeltdach hat einen quadratischen oder rechteckigen Grundriss, die Gradlinien laufen in einem Punkt (Firstpunkt) zusammen.
-
Zeltdach
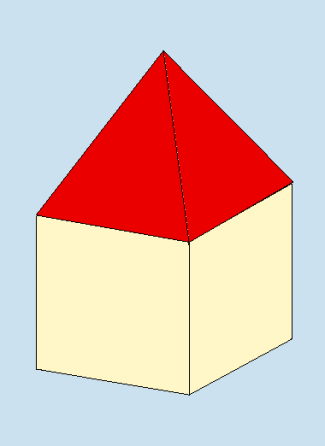
Aneinandergereihte Satteldächer, wie es bei Industriebauten oft der Fall ist, bezeichnet man als Sägedächer.
Durch Größe und Form des Daches wird das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes wesentlich bestimmt. In die Dachflächen können Fenster, Gauben und Loggien zur besseren Dachraumnutzung eingebaut werden. Gauben, z. B. Fledermausgaube, Sattelgaube, Schleppdachgaube sind Dachaufbauten, in die senkrecht Fenster eingebaut werden. Loggien sind Dacheinschnitte.
Dachkonstruktionen
Dachkonstruktionen aus Holz sind meist Sparrendächer, Kehlbalkendächer und Pfettendächer. Eine Sparrendachkonstruktion besteht aus Sparren, Widerlager, Firstbrett und Windrispe. Mit der Decke bilden die Sparren ein unverschiebbares Dreieck. Die Windrispe stabilisiert diese Dreiecke gegen Windbelastung und dient der Längsaussteifung.
-
Aufbau eines Sparrendaches
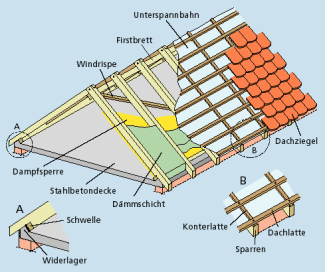
Sparrendächer werden bei Gebäudebreiten bis zu 8 Metern verwendet. Die Sparrenlänge sollte 4,5 Meter nicht überschreiten. Sollte es doch notwendig sein, so müssen zusätzlich Kehlbalken angebracht werden. Wenn Kehlbalken die Sparren aussteifen, so wird diese Dachkonstruktion als Kehlbalkendach bezeichnet. Das Kehlbalkendach ist somit eine Weiterentwicklung des Sparrendaches.
Eine Pfettendachkonstruktion besteht aus Sparren, Firstpfette, Kopfband, Lattung, Firstlaschen, Binder, Schwelle und Pfosten. Die Sparren sind mit Pfette und Schwelle fest in der Decke verbunden. Zwischen Pfosten, Sparrenpaar, Zangen und Decke entsteht ein unverschiebbares Dreieck. Diese Konstruktion dient der Queraussteifung des Daches. Längsaussteifung erreicht man über die Kopfbänder, die mit Bundpfosten und Pfette ein unverschiebbares Dreieck bilden.
Abwechslungsreiche „Dachlandschaften“ entstanden bei den großen Kathedralen, bei historischen ostasiatischen Bauten, aber auch in den Altstädten Mitteleuropas. Seit dem vorigen Jahrhundert wird das Dach verstärkt zum Form-Ausdruck eines Baus und zu seiner Symbolisierung eingesetzt.

