Zufallskompositionen
Als Zufallskompositionen bezeichnet man Werke, deren Form offen ist, so dass die musikalische Verwirklichung dem Zufall überlassen bleibt. Diese Kompositionstechnik, die auch Aleatorik genannt wird, hielt Anfang der 1950er-Jahre Einzug in die Musik und ist eine Gegenreaktion auf den Rationalismus der seriellen Musik. Der Komponist gibt nur allgemeine Spielanweisungen oder stimulierende Grafiken vor, die die Interpreten individuell und durch spontane Aktionen umsetzen. So können Teile eines Stückes weggelassen oder ausgetauscht werden, der Interpret kann an einer beliebigen Stelle anfangen oder aufhören sowie Tondauer, Tonhöhen, Klangfarben usw. aus einem gegebenen Vorrat selbst wählen. Die realisierte Werkgestalt ist dem Komponisten nicht mehr bekannt, da die Möglichkeiten der Interpreten nahezu unbegrenzt sind. Initiator dieser Form des Musizierens war der amerikanische Komponist JOHN CAGE (1912–1992). Neben ihm sind PIERRE BOULEZ (1925-2016) und KARLHEINZ STOCKHAUSEN (* 1928) die wichtigsten Vertreter solcher Zufallskompositionen.
Zum Begriff Zufallsmusik
Statt auf traditionelle Kompositionstechniken zurückzugreifen, überließen die Komponisten die Entscheidungen über den Verlauf des Stückes nun dem Zufall, um auch beim Hörer eine neue Offenheit dem musikalischen Geschehen gegenüber zu erreichen. Zu den wichtigsten Vertretern dieser Form des Komponierens gehörten
- PIERRE BOULEZ (1925-2016),
- KARLHEINZ STOCKHAUSEN (* 1928) sowie
- JOHN CAGE (1912–1995),
- der polnische Komponist WITOLD
- LUTOSLAWSKI (1913–1994).
Eine wichtige Rolle für die Prägung des Begriffs spielte PIERRE BOULEZ, der 1956 auf den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik einen mit „Alea“ betitelten bahnbrechenden Vortrag hielt. „Alea“ ist das lateinische Wort für Würfel sowie für Zufall und genauso zufällig wie ein Würfelspiel sollte nun auch die Musik sein. Daher bezeichnete man diese Kompositionstechnik auch als Aleatorik. Allerdings wird dieser Terminus in der Musik nicht einheitlich gebraucht, weil die Komponisten, die sich solcher Zufallsoperationen bedienten, den Begriff nicht systematisch gebrauchten.
Das Offenlassen der Form und der kalkulierte Zufall hat freilich nichts mit unkontrollierter Willkür zu tun hat. Vielmehr sind die Werke variabel und damit vieldeutig in ihrer musikalischen Gestalt. Es sind keine in sich geschlossenen Kunstwerke mehr. Der Komponist gibt als Ausgangssituation allgemeine Spielanweisungen oder Grafiken vor, die ein Muster für den Verlauf der Interpretation darstellen. Der Interpret setzt diese dann individuell und spontan um. So können beispielsweise
- Teile eines Stückes weggelassen oder ausgetauscht werden,
- der Ausführende kann an einer beliebigen Stelle anfangen oder aufhören sowie
- Tondauer, Tonhöhen, Klangfarben usw. aus einem gegebenen Vorrat selbst wählen.
Im strengen Sinn aleatorisch wird das Ergebnis demnach erst durch den Musiker, der das Werk nach seinen Vorstellungen umsetzt, besser gesagt als Werk erst erschafft. Der Interpret ist hier in neuartiger Weise in das Komponieren einbezogen, da ihm eine Vielzahl von Entscheidungsmöglichkeiten eingeräumt werden.
Zufallskompositionen werden als ein universelles Verfahren begriffen, das auf jede Art von Material angewendet werden kann. Statt mit dem bekannten Tonsystem zu arbeiten, wird hier u.a. mit Geräuschen gespielt, um zu neuen ästhetischen Erfahrungen zu gelangen.
Mitte der 1960er-Jahre wird diese Kompositionstechnik zu einem Kunstmittel, das sich von seinem kompositionstheoretischen Hintergrund gelöst hat und vielfältig eingesetzt wird. Zufallskompositionen treten dabei in sehr verschiedenen Ausprägungen auf. So sind die Kompositionen von STOCKHAUSEN und BOULEZ in Anlage und Konzept von denen CAGEs zu unterscheiden.
Die europäische Tradition
In Europa entwickelt sich die Zufallskomposition direkt aus den Denk- und Verfahrensweisen der seriellen Musik und ist zugleich deren genauer Gegensatz. Protagonisten dieses Stilmittels sind
- KARLHEINZ STOCKHAUSEN und
- PIERRE BOULEZ,
die ihre Werke bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik vorstellten und diskutierten. In diesem Umfeld entwickelt sich der Begriff Aleatorik bzw. aleatorische Komposition, womit Musik beschrieben wird, die außerhalb von kompositorischen Vorstellungen liegt. Der Auftritt von JOHN CAGE 1958 und seine europäische Erstaufführung des 1957/1958 entstandenen „Concert for Piano and Orchestra“ in Köln waren von großem Einfluss auf die europäische Entwicklung.
Ein Beispiel ist KARLHEINZ STOCKHAUSENs „Klavierstück XI“ (1956). Hier wird dem Interpreten die Abfolge der verschiedenen genau auskomponierten Teile der Komposition überlassen, wobei er bei jeder Aufführung eine andere (zufällige) Entscheidung treffen soll, indem er absichtslos auf den speziell eingerichteten Notentext blickt. In der Komposition „Momente“ (1961–1964) kann der Interpret an bestimmten Stellen nachträglich Einschübe einfügen. Aus zufälligen Signalen, die die Spieler mit Radioempfängern aus dem Kurzwellenband auffangen und dann darauf reagieren, wird die 1968 entstandene Komposition „Kurzwellen“ im Moment der Aufführung zusammengefügt. Ab 1970 kehrt STOCKHAUSEN wieder zur vollständig ausgearbeiteten Komposition zurück.
PIERRE BOULEZ hingegen nutzt die Konzeption des Zufalls bis in sein spätes Schaffen. Beispiele seiner Werke sind
- „Structures II“ (1956–1961),
- „Improvisation sur Mallarmé III“ (1959),
- „Tombeau“ (1959–1962).
-
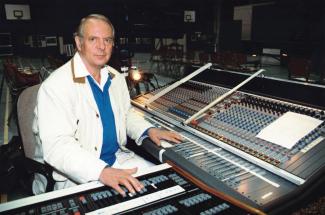
Niklaus Stauss - picture-alliance / akg-images
Die amerikanische Tradition
In Amerika bildet sich die Zufallskomposition bereits Anfang der 1950er-Jahre heraus. JOHN CAGE ist der wichtigste Komponist und seine Forderung ist es, dass nun alles zu musikalischem Material werden solle. CAGE studierte bei HENRY COWELL (1897–1965), der als Vorläufer dieser Zufallskomposition zu bezeichnen ist. COWELLs 3. Streichquartett „Mosaic“ (1935) überlässt die Reihenfolge der kurzen Sätze dem Belieben des Interpreten. Diese sogenannte „elastische Form“ greift CAGE auf und verwendet Zufallsoperationen zuerst zur Erstellung der Orchesterstimmen seines „Concerto for prepared Piano and Chamber Orchestra“ (1951). Er benutzt dabei eine aus dem chinesischen Orakelbuch „I Ging (Yi Jing)“ abgeleitete Methode des Münzwurfes.
- Sehr außergewöhnlich ist die Komposition „4’33“ („tacet“ in 3 Sätzen für beliebige Instrumente, 1952), denn die viereinhalbminütige Musik besteht aus gänzlichem Schweigen und nur die zufälligen Geräusche innerhalb und außerhalb des Konzertraumes sind zu hören.
- Beim Stück „Music for Piano 21–52“ (1955) werden die zufälligen Unreinheiten des Papiers in Noten verwandelt.
- Das „Concert for Piano and Orchestra“ (1957/58) lässt die Spieler entscheiden, in welcher Auswahl, Realisationsweise und Reihenfolge sie die Notationsbilder und das Stimmenmaterial zum Klingen bringen.
Die amerikanische Tradition verzichtet bewusst auf den Begriff Aleatorik und verwendet die Ausdrücke
- Zufall („Chance“) und
- Unbestimmtheit („Indeterminacy“).
CAGE bezeichnet seine Kompositionen als „experimentelle Musik“, da sie auf absichtslosen Handlungen basieren und Ergebnisse unvorhersehbar sind; die Klänge ereignen sich sozusagen. Seine Werke bewegen sich in einem antitheoretischen Raum.
Notation/Grafik
Charakteristisch für Zufallskompositionen ist die grafische Darstellung. Anstelle einer Notenschrift gibt es Grafiken, Zeichen und Figuren, die spontan als Musik versinnlicht werden sollen. Es gibt häufig keine Taktstriche, Unreinheiten auf dem Papier werden zu Noten und Gedichte werden zu Notentexten. MORTON FELDMAN (1926–1987) beispielsweise verwendet für seine Kompositionen zur „Intersection- und Projection-Reihe“ Rechtecke anstelle von Noten. Die Länge der Rechtecke bestimmt die Dauer und die Tonhöhe ist durch die relative Höhe symbolisiert. Die grafische Notation ist hier zum Kunstmittel geworden, das frei angewendet werden kann.
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Vertreter
- Klavierstück XI
- chinesisches Orakelbuch
- Intersection- und Projection-Reihe
- Witold Lutosławski
- Momente
- Notationsbilder
- Yi Jing
- Chance
- Improvisation sur Mallarmé III
- Music for Piano 21–52
- KARLHEINZ STOCKHAUSEN
- Alea
- Aleatorik
- serielle Musik
- Grafiken
- Indeterminacy
- Interpretation
- Würfelspiel
- Concerto for prepared Piano and Chamber Orchestra
- Amerika
- PIERRE BOULEZ
- Structures II
- aleatorische Komposition
- 4’33
- I Ging
- experimentelle Musik
- Europa
- Rationalismus
- John Cage
- HENRY COWELL
- tacet
- Tombeau
- Kompositionstechnik
- Spielanweisungen
- Mosaic
- Zufallskompositionen
- grafische Darstellung
- Interpret
- MORTON FELDMAN
- Kurzwellen
- Münzwurf
- elastische Form
- Concert for Piano and Orchestra

