Musizieren als Theater bei Kagel und Schnebel
Der kompositionsgeschichtliche Wandel, der sich ab 1950 vollzog, brachte um 1960 neue Formen des Musiktheaters hervor. Neben der Hauptform der Literaturoper entwickelten sich verschiedene musiktheatrale Spielarten, die nicht unmittelbar an die Tradition der Oper anknüpften, sondern einem musikalischen Denken entsprungen waren, das eine neue Form der Synthese von Sprache, Musik und Szene suchte und das Selbstverständnis traditioneller Formen und kultureller Konventionen in Frage stellte. Für diese gibt es eine Reihe von Bezeichnungen wie beispielsweise
- „Musikalisches Theater“,
- „Sichtbare Musik“,
- „Instrumentales Theater“,
- „Visuelle Musik“,
- „Audiovisuelle Musik“,
- „Szenische Musik“ oder
- „Medienkomposition“.
Die Einbeziehung des Optischen und Gestischen in die kompositorische Erfindung ist diesen Spielarten ebenso gemeinsam wie das Fehlen einer durchgehenden dramatischen Handlung. Die Szene ist nicht wie in der Oper durch den Handlungsverlauf eines Textes bestimmt, sondern durch andere Kriterien organisiert.
Theatralisierung des Musizierens
Die Theatralisierung des Musizierens vollzog sich parallel zur Erweiterung des musikalischen Materials und der Hinwendung zur „offenen Form“, zu der Idee, die Komposition als Prozess zu begreifen. Oft steht die Klangerzeugung, also die Aktion des Musizierens, dabei im Mittelpunkt und bestimmt den Verlauf der Komposition. Deren Ausgang ist damit nicht mehr vorhersehbar, sie entsteht bei jeder Aufführung also „neu“.
Den Anstoß für diese Entwicklung gab JOHN CAGE (1912–1992). In seinen experimentellen Stücken, die zu den Ursprüngen der Happening-Bewegung gehören, spielen theatrale Momente eine entscheidende Rolle. So hat in seiner „Water Music“ (1952) der Pianist in einem vorgegebenen Zeitrahmen Tasten anzuschlagen, aber auch andere Aktionen, wie
- das Einschalten eines Radios,
- das Präparieren des Flügels oder
- das Blasen und Pfeifen auf einer Wasserschale,
zu vollziehen. Das szenische Moment des Musizierens, die theatrale Qualität von Musik durch das Zusammenspiel von Optischem und Akustischem, wird hier ins Bewusstsein gerufen. Die Aktionen treten in den Mittelpunkt und werden durch den Komponisten gestaltet und miteinander verknüpft.
Kompositionsgeschichtlich kann man die neuen Formen des Musiktheaters auch als eine Konsequenz des seriellen Denkens betrachten, das in den 1950er-Jahren seinen Höhepunkt erreichte und hier nun alle Dimensionen des Klanges – einschließlich des Raumes, in dem er sich entfaltet – mit einschließt. Das Orchester wird am Aufführungsort um das Publikum herum gruppiert oder die Musiker bewegen sich durch den Raum, z.B. bei dem Stück „Gruppen“ für drei Orchester (1955–1957) von KARLHEINZ STOCKHAUSEN (* 1928). Auch die neuen musikalischen Möglichkeiten, die die elektronische Musik bietet, und aufführungstechnische Bedingungen haben hier zu neuen musikalischen Perspektiven geführt. In seinem Stück „Gruppen“ für drei Orchester (1955–1957) bewegen sich die Musiker durch den Raum.
-
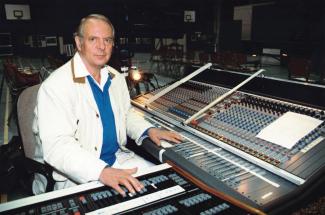
Niklaus Stauss - picture-alliance / akg-images
DIETER SCHNEBEL: Sichtbare Musik
Sichtbare Musik ist Musik, die des Zuschauens bedarf, weil sie sich ins Optische entfaltet. DIETER SCHNEBEL (* 1930), der für die Theatralisierung der Musik den Begriff „Sichtbare Musik“ prägte, betonte
- die Bedeutung des Raumes in der Musik,
- die der Bewegung der Musiker und ihres gestischen Spiels und
- die Einbeziehung außermusikalischer Elemente und anderer Kunstformen, beispielsweise
– des Theaters,
– der Bildenden Kunst und
– des Films.
Das Szenische – Bewegungen und Gestisches – erhält gegenüber der Musik einen eigenen Wert. Hören und Sehen sind gleichermaßen wichtig.
- Sprache und Sprechen,
- Vokalklang,
- Instrumentalklang,
- Geräusch,
- Bild,
- Bewegung und Gestik
werden autonom, als voneinander unabhängige Ausdrucks- und Gestaltungsmittel behandelt, beispielsweise in
- „Glossolalie. Präpariertes Material für Sprecher und Instrumentalisten“ (1959/1960) und
- „Glossolalie 1961. Musik für einen Sprecher und Instrumentalisten“ (1960/1961, rev. 1962).
Dies ist mit einer Auflösung der traditionellen Aufführungspraxis verbunden. Eine experimentelle kompositorische Praxis erlaubt, das erweiterte musikalische Material strukturell und formal auf neue Art und Weise zu organisieren.
Musik als Theater, das bedeutete auch, die Musik selbst zu hinterfragen und ihre gesellschaftlichen Bedingungen offenzulegen. In der Auseinandersetzung mit der Musik und Ästhetik der Avantgardewegung, mit JOHN CAGE und Fluxus (intermediale Kunstform, in der Elemente aus Musik, Theater, Film, Kunst, Literatur und elektronischen Medien gleichberechtigt genutzt wurden), schrieb DIETER SCHNEBEL um 1960 eine Reihe von Stücken, die die Musik selbst und ihre aufführungspraktischen Konventionen zum Thema machen und zur Schau stellen. Dazu gehört beispielsweise die kleine Werkreihe „Visible music I–III“ (1960/1961). Anfang der 1960er-Jahre wurden die Stücke mit großem Erfolg, aber auch skandalumwittert uraufgeführt. Beim Publikum, das teilweise auch einbezogen ist, riefen diese Werke oft Irritationen hervor.
- SCHNEBELs „Visible music I“ (1960), für einen Dirigenten und einen Instrumentalisten, lässt den Instrumentalisten und den Dirigenten in einen Wettstreit treten. Hier werden die Verhaltensmuster des Musizierens thematisiert und in den Kontext sozialer Machtverhältnisse gebracht.
- „Visible music II, nostalgie“ (1960) ist ein Solo für einen Dirigenten, in dem der Dirigent der Partitur folgend Musik in all ihren Parametern in die Luft zeichnet. Die Musik ist allein seinen Gesten zu entnehmen, der Konzertsaal bleibt still.
- Die „visible music III, espressivo (Musikdrama) für einen Pianisten“ (1961) führt das „Drama“ der Einstudierung des Musikstücks durch den Interpreten theatralisch vor und bringt damit einen Prozess auf die Bühne, der bis zu diesem Zeitpunkt allein im Probenraum der Musiker stattfand.
Sprache, Gestik, Verhalten und Kommunikation sind die Angelpunkte des gesamten künstlerischen Schaffens von SCHNEBEL.
- Zu seinen klanglosen Werken theatralischen Charakters, in denen komponierte Gesten und Körperbewegungen zu Musik werden, gehört z.B. auch „Körper-Sprache. Organkomposition für 3–9 Ausführende“ (1979/1980).
- In der Musikgeschichte ohne Vorbild ist sein „Theater“ der Organbewegungen, die „Maulwerke für Artikulationsorgane und Reproduktionsinstrumente“ (1968–1974).
MAURICIO KAGEL: Instrumentales Theater
Auch MAURICIO KAGEL (* 1931) komponierte um 1960 eine Reihe von Werken, in denen das Theatrale der Musik und des Musizierens im Mittelpunkt steht und die neue Formen des Musiktheaters hervorbrachten. Schon seit den 1950er-Jahren experimentierte KAGEL mit verschiedenen Schallträgern, mit elektroakustischen und audiovisuellen Medien und ist Komponist wie Regisseur seiner Werke, für
- Konzert,
- Theater,
- Film,
- Hörspiel und
- Fernsehen.
Wie auch SCHNEBEL beschäftigte sich KAGEL mit den Bedingungen des Musizierens und der Aufführung. KAGELs „Instrumentales Theater“ bezieht
- Mimik,
- Bewegungsverläufe und
- räumliche Aspekte wie auch
- ein breites und multimediales Instrumentarium sowie
- Elemente des Alltags mit ein
- und zielt auf eine Kritik an traditionellen und ritualisierten Formen des Konzertbetriebs.
Ins Zentrum rücken das „Musikmachen“, also das Hervorbringen von Klängen und die Aktionen der Interpreten, die hier zu schauspielernden Musikern werden. Verbunden damit sind
- eine Psychologisierung der Aufführung und
- eine Steigerung der Aufmerksamkeit des Publikums für Außermusikalisches, für Dinge des Alltags und für die „Nebenprodukte“ des Musizierens, die nun in einem künstlerischen Kontext erscheinen.
Der Effekt der Verfremdung tritt hier in Erscheinung und „Altes“ erscheint in neuem Zusammenhang. KAGEL bedient sich u.a. des Mittels der Montage und verwendet unterschiedliche Medien, um den eindeutigen semantischen Bezug des musikalisch verwendeten Materials aufzulösen und das Moment der Offenheit und Vieldeutigkeit zu erreichen. Zum „Instrumentalen Theater“ KAGELs gehören beispielsweise die Stücke
- „Transición II“ (1958–1959) für Klavier, Schlagzeug und zwei Tonbänder,
- „Sonant“ (1960) für Gitarre, Harfe, Kontrabass und Fellinstrumente,
- „Heterophonie“ (1959–1961) für Orchester (nur Soloinstrumente),
- „Staatstheater“ (1971), eine szenische Komposition, und
- „Sur scéne“ (1959–1960), ein „Kammermusikalisches Theaterstück“, das sehr eindeutig Musik als Theater vorführt und durch einen montierten Text, der von einem „musikprofessorähnlichem Sprecher“ vorgetragen wird, die vielfach übliche sprachliche Reflexion über Musik als Persiflage ausstellt.
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Instrumentalklang
- Theater
- Transición II
- Das Szenische
- Komponist
- Theatralisierung des Musizierens
- Water music
- Gestisches
- instrumentales Theater
- Hören
- Mimik
- elektronische Musik
- Sprache
- DIETER SCHNEBEL
- serielles Denken
- Verfremdung
- Fernsehen
- Klangerzeugung
- John Cage
- Bewegungen
- Film
- Montage
- Gestik
- Sichtbare Musik
- Fluxus
- Avantgardewegung
- Heterophonie
- Bildende Kunst
- Geräusch
- Kammermusikalisches Theaterstück
- Optisches
- Raum
- Staatstheater
- MAURICIO KAGEL
- Bild
- Sonant
- Hörspiel
- Dirigent
- Konzert
- Körper-Sprache. Organkomposition für 3-9 Ausführende
- Glossolalie
- Sur scène
- Komposition
- Maulwerke für Artikulationsorgane und Reproduktionsinstrumente
- Vokalklang
- Musiktheater
- Sprecher
- Sehen
- klanglose Werke
- KARL HEINZ STOCKHAUSEN
- Sprechen
- Visible music I-III
- Akustisches
- Instrumentalist

