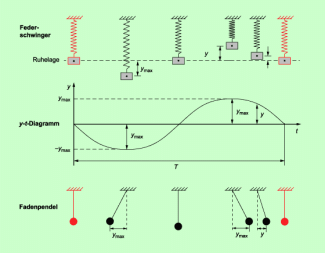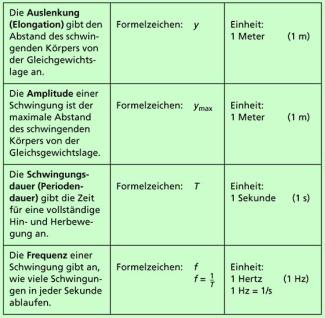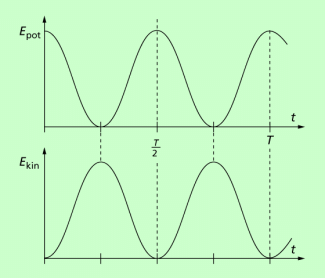Beschreibung mechanischer Schwingungen
Eine mechanische Schwingung ist eine zeitlich periodische Bewegung eines Körpers um eine Ruhelage. Solche Schwingungen kann man
- in verschiedener Weise aufzeichnen,
- in einem y-t-Diagramm darstellen oder
- mithilfe solcher physikalischer Größen wie der Auslenkung, der Amplitude, der Schwingungsdauer (Periodendauer) und der Frequenz charakterisieren.
Eine mechanische Schwingung kann in unterschiedlicher Weise beschrieben werden. Nachfolgend sind die wichtigsten Möglichkeiten der Beschreibung von Schwingungen dargestellt.
Beschreibung durch Schwingungsaufzeichnung
Der Verlauf von Schwingungen kann in unterschiedlicher Weise aufgezeichnet und damit sichtbar gemacht werden. Die Schwingungen von Stimmgabeln kann man z. B. mit einem Mikrofon empfangen und mit einem Oszillografen sichtbar machen (Bild 1). Eine ähnliche Schwingungskurve erhält man, wenn man eine angeschlagene Stimmgabel mit Schreibspitze über eine berußte Glasplatte zieht.
Die Schwingungen von schweren Fadenpendeln kann man aufzeichnen, wenn man am Pendelkörper in einer Hülse einen senkrecht beweglichen Schreibstift anbringt, die Spitze des Schreibstiftes auf weißes Papier setzt und bei schwingendem Pendel das Papier gleichmäßig wegzieht.
Beschreibung durch ein y-t-Diagramm
Eine Schwingung kann man genauer beschreiben, wenn man den zeitlichen Verlauf der Auslenkung y darstellt. Man erhält dann ein y-t-Diagramm dieser Schwingung (Bild 2). Der Kurvenverlauf entspricht den jeweiligen Schwingungszuständen. In Bild 2 ist in der Mitte ein y-t-Diagramm angegeben. Oben und unten sind die zugehörigen Schwingungszustände für einen Federschwinger und ein Fadenpendel dargestellt.
Beschreibung durch physikalische Größen
Schwingungen kann man mit den physikalischen Größen Auslenkung (Elongation), Amplitude, Schwingungsdauer (Periodendauer) und Frequenz beschreiben. Diese vier Größen sind in der nachfolgenden Übersicht genauer charakterisiert.
Frequenz und Schwingungsdauer
Frequenz und Schwingungsdauer sind wichtige Größen sowohl für die Beschreibung von mechanischen wie auch von nichtmechanischen Schwingungen. Sie hängen eng miteinander zusammen.
Die Frequenz gibt die Anzahl der schwingungen je Sekunde an. Die Schwingungsdauer, auch Periodendauer genannt, ist die Zeitdauer für eine vollständige Schwingung, also für ein einmaliges Hin- und Herschwingen.
Einheit der Frequenz ist ein Hertz (1 Hz), benannt nach dem deutschen Physiker HEINRICH HERTZ (1857-1894), der die elektromagnetischen Schwingungen und Wellen entdeckt hat.
Vielfache der Einheit 1 Hz sind ein Kilohertz (1 kHz) und ein Megahertz (1 MHz):
| 1 kHz = 1 000 Hz 1 MHz = 1 000 kHz = 1 000 000 Hz |
Die nachfolgende Übersicht zeigt einige Werte für Frequenzen.
![]()
Die Frequenz kann berechnet werden mit den Gleichungen:
Beschreibung durch eine Gleichung
Körper können in sehr unterschiedlicher Weise schwingen.
Für harmonische Schwingungen, z. B. die Schwingungen eines Federschwingers oder eines Fadenpendels bei kleinen Auslenkungen, lässt sich eine Schwingungsgleichung angeben, durch die der Verlauf der Schwingung beschrieben wird.
Unter der Bedingung, dass eine harmonische Schwingung vorliegt, gilt:
Der Ausdruck wird auch als Kreisfrequenz bezeichnet. Damit erhält man als Schwingungsgleichung:
Da harmonische Schwingungen mit einer Sinusfunktion beschrieben werden, spricht man auch von sinusförmigen Schwingungen. Daneben gibt es aber eine Vielzahl von Schwingungen, die nicht sinusförmig verlaufen.
Hat eine harmonische (sinusförmige) Schwingung zum Zeitpunkt t = 0 den Phasenwinkel , dann muss das in der Schwingungsgleichung berücksichtigt werden. Sie lautet dann:
Aus der Schwingungsgleichung lassen sich auch Aussagen über den Verlauf der Geschwindigkeit und der Beschleunigung bei harmonischen Schwingungen ableiten.
Die Geschwindigkeit ergibt sich als erste Ableitung der Elongation nach der Zeit:
Diese maximale Geschwindigkeit wird beim Durchgang durch die Gleichgewichtslage erreicht. In den Umkehrpunkten ist sie null.
Die Beschleunigung ergibt sich als erste Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit bzw. als zweite Ableitung der Elongation:
Die maximale Beschleunigung wird in den Umkehrpunkten erreicht. Beim Durchgang durch die Gleichgewichtslage ist sie null.
Energie bei harmonischen Schwingungen
Geht man von einer ungedämpften harmonischen Schwingung aus, dann ändert sich bei mechanischen Schwingern ständig die potenzielle und die kinetische Energie, wobei die Gesamtenergie gleich bleibt (Bild 4).
Daher kann man die Energie eines harmonischen Oszillators z.B. aus seiner maximalen Geschwindigkeit berechnen, weil zum Zeitpunkt der maximalen Geschwindigkeit die kinetische Energie maximal und die potenzielle Energie null sind. Damit erhält man:
Bei einem Federschwinger kann man die Energie des Schwingers auch mithilfe der Federkonstanten (Richtgröße, Rückstellfaktor) ausdrücken und erhält dann für die Energie den Ausdruck:
Kraftgesetz für harmonische Schwingungen
Bei einer harmonischen mechanischen Schwingung ist die rücktreibende Kraft proportional zur Auslenkung. Es gilt stets:
Durch das Minuszeichen wird die entgegengesetzte Richtung von Auslenkung und Kraft zum Ausdruck gebracht. Die Kraft wirkt stets entgegen der Auslenkung in Richtung Gleichgewichtslage.
Es gilt auch die umgekehrte Aussage: Besteht zwischen rücktreibender Kraft und Auslenkung bei einem Vorgang Proportionalität, so liegt eine harmonische Schwingung vor. Die Proportionalität zwischen rücktreibender Kraft und Auslenkung ist somit ein Kriterium dafür, ob eine harmonische Schwingung vorliegt oder nicht.
Das Kraftgesetz lässt sich folgendermaßen ableiten:
Dieses Gesetz wird als Kraftgesetz für harmonische Schwingungen bezeichnet. Den Faktor D nennt man Richtgröße, Rückstellfaktor oder bei Federn auch Federkonstante. Die Gleichung ermöglicht auch die Bestimmung dieser Richtgröße durch Messung von Kraft F und zugehöriger Auslenkung y.