Blitze und Blitzschutzanlagen
Blitze sind elektrische Entladungen zwischen Wolken bzw. zwischen einer Wolke und der Erdoberfläche. Die mittlere Stromstärke beträgt ca. 40.000 A bei einem Durchmesser der Blitze von 10 bis 20 cm, ihre Länge meist 2 bis 3 km und ihre Dauer weniger als 1 s. Weltweit werden 70 bis 100 Blitze in jeder Sekunde registriert.
Blitze können erhebliche Schäden hervorrufen. Um sich vor solchen Schäden zu schützen, werden in gefährdeten Gebieten an Gebäuden Blitzschutzanlagen angebracht. Vor Blitzen geschützt ist auch ein von Metall umgebener Raum, etwa eine Pkw-Karosserie. Sie wirkt wie ein FARADAY-Käfig. Elektronische Geräte oder Kabel werden durch eine metallische Ummantelung vor starken elektrischen Feldern abgeschirmt.
Blitze und Gewitter
Ein Blitz ist ein zeitlich kurzer, aber sehr starker elektrischer Strom, der die unterschiedlichen Ladungen zwischen geladenen Wolken bzw. Wolken und der Erde ausgleicht. Die mittlere Stromstärke beträgt ca. 40.000 A bei einem Durchmesser der Blitze von 10 bis 20 cm, ihre Länge meist 2 bis 3 km und ihre Dauer weniger als 1 s. Weltweit werden 70 bis 100 Blitze in jeder Sekunde registriert. In Deutschland nimmt die Anzahl der jährlichen Gewittertage und der Blitzeinschläge je Quadratkilometer von Norden nach Süden zu und ist in den Sommermonaten (Juli, August) etwa fünfmal so groß wie in den Wintermonaten (Dezember, Januar, Februar). In Deutschland werden jährlich im Durchschnitt mehr als 750.000 Blitze gezählt. Verschiedene Wetterdienste im Internet veröffentlichen aktuelle Blitzkarten, aus denen man die Blitzhäufigkeit in bestimmten Regionen ablesen kann.
Verbunden mit Blitzen ist Donner. Er kommt folgendermaßen zustande: In Blitzen herrschen hohe Temperaturen. Da sich Gase bei Temperaturerhöhung ausdehnen, dehnt sich auch die Luft in der Nähe um einen Blitz kurzzeitig sehr stark aus, was zu erheblichen Druckänderungen führt. Diese Druckänderungen breiten sich als Schallwellen aus und sind als Donner zu hören.
Zur Entstehung von Blitzen wurden unterschiedliche Theorien entwickelt. Durchgesetzt hat sich die folgende Auffassung: Elektrisch geladene Gewitterwolken entstehen vor allem an warmen, schwülen Tagen. Warme, aber auch feuchte Luft steigt nach oben. Dabei kühlt sie sich ab. Aus dem in der Luft befindlichen Wasserdampf werden dadurch Wassertropfen, Eiskristalle und Hagelkörner. Der Mechanismus der Ladungstrennung in der Wolke ist noch nicht in allen Einzelheiten geklärt. Ein Erklärungsansatz ist folgender: Ein Teil der aufgestiegenen Hagelkörner fällt wieder herab, weil sie zu schwer sind. Durch das schnelle Aufsteigen von Luft mit Wassertropfen und Eiskristallen sowie das Herabfallen von Hagelkörnern kommt es infolge von Reibung zu Ladungstrennungen. Damit entstehen in Gewitterwolken Bereiche, die unterschiedlich geladen sind (Bild 1).
Wenn die unterschiedlichen Ladungen in Gewitterwolken groß genug sind, kommt es zu einem Ladungsausgleich durch einen Blitz. Dabei wandern Elektronen zum positiv geladenen Körper.
Blitze schlagen vor allem in hohe, spitze Gegenstände ein, z.B. in hohe Bäume, Kirchturmspitzen oder Spitzen von Dächern. Solche Stellen sind somit besonders gefährdet und müssen besonders geschützt werden.
Blitzschutz und Blitzschutzanlagen
Nicht nur Gebäude und Anlagen, sondern auch der Mensch selbst ist gefährdet, wenn er sich bei Gewitter im Freien aufhält. Die Verletzungen, die durch Blitze auftreten, können aufgrund der erheblichen Stromstärken und Spannungen tödlich sein. Die Formulierung „vom Blitz erschlagen“ ist real. Darüber hinaus können Verbrennungen, Herzschädigungen, Nerven und Muskellähmungen, Seh- und Gehörschädigungen auftreten.
Deshalb sollte man bei Gewittern grundsätzlich vorsichtig sein und einige Regeln beachten, wenn man im Bereich eines Gewitters ist:
- Besonders gefährdet sind Bäume, Masten oder andere hervorstehende Gegenstände, aber auch Außenwände von Gebäuden. Dort sollte man sich nicht aufhalten.
- Auch in der Nähe von Bäumen, Masten usw. besteht eine Gefährdung, weil sich der Blitzstrom von der Einschlagstelle aus nach allen Richtungen im Boden ausbreitet. Dadurch kann z.B. zwischen den Füßen einer Person eine erhebliche Spannung, die sogenannte Schrittspannung, auftreten.
- Wenn man im Freien von einem Gewitter überrascht wird, dann ist es am sichersten, sich in eine Mulde zu hocken und die Füße eng nebeneinanderzusetzen, um die Schrittspannung so klein wie möglich zu halten.
- Besonders sicher sind geschlossene Räume, die über eine Blitzschutzanlage verfügen. Sicher sind auch Pkw, wie weiter unten erläutert wird.
-
Aufbau einer Gewitterwolke
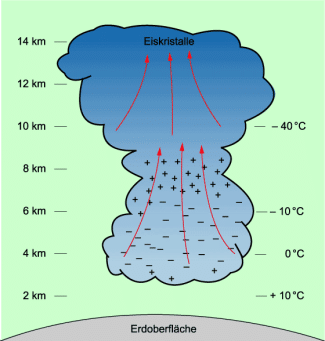
Gefährdet sind nicht nur Lebewesen, sondern auch Gebäude sowie technische Anlagen und elektronische Geräte, die durch Blitzeinwirkungen erheblich geschädigt werden können.
Um Gebäude vor Schäden durch Blitzeinschlag zu schützen, werden in gefährdeten Gebieten Blitzschutzanlagen angebracht. Diese sind so konstruiert, dass der Blitz in diese Anlagen (Blitzableiter) einschlägt und gefahrlos in die Erde abgeleitet werden kann. Der erste Blitzableiter wurde von dem amerikanischen Staatsmann und Naturforscher BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790) gebaut. Eine Blitzschutzanlage besitzt Fangstäbe und Fangleitungen, die die höchsten Stellen des Hauses bilden, sodass der Blitz dort einschlägt. Über dicke Eisendrähte wird der elektrische Strom des Blitzes in die Erde abgeleitet. Die Erdung erfolgt durch Platten und Kupfernetze, die möglichst in das Grundwasser versenkt werden. Hinzu kommt eine Sicherung des elektrischen Netzes im Gebäude durch Erdung. Diese Schutzmaßnahmen werden in der Technik als Grobschutz bezeichnet. Hinzu kommt meist noch ein Feinschutz in Form von Sicherungen in einzelnen Anlagen und Geräten.
Der faradaysche Käfig
Unter einem FARADAY-Käfig versteht man einen Metallkäfig oder einen von Metall oder einem Metallgitter umgebenen Raum. Benannt ist er nach MICHAEL FARADAY (1791-1867). FARADAY stellte fest, dass ein solcher Raum feldfrei bleibt. Das gilt auch, wenn eine starke elektrische Entladung auftritt, also z.B. ein Blitzeinschlag erfolgt. Damit ist man in einem solchen FARADAY-Käfig vor elektrischen Einschlägen sicher. Der Käfig wirkt als Abschirmung.
Die Karosserien von Autos oder Flugzeughüllen sind solche FARADAY-Käfige. Man ist deshalb in einem Auto oder in einem Flugzeug vor einem Blitzschlag geschützt. Bei Cabrios reicht zur Abschirmung schon der Metallrahmen des Daches. Allerdings können starke elektrische Entladungen trotzdem zu Störungen bei elektronischen Bauteilen führen. Ein Restrisiko bleibt.
FARADAY-Käfige nutzt man auch zur Abschirmung von Kabeln : Übertragungskabel für Computer oder Antennenkabel sind von einem Drahtgeflecht aus Kupfer umgeben. Dieses Drahtgeflecht bewirkt, dass keine elektrischen Felder von außen die übertragenen Daten beeinflussen können. Die Abschirmung bewirkt eine störungsfreie Datenübertragung. Dieser Schutz ist aber auf „normale“ Störeinflüssen beschränkt. Auch hier können starke elektrische Entladungen, wie sie z.B. bei Blitzen auftreten, zu erheblichen Störungen führen.

