Auge
Das menschliche Auge ist ein kompliziertes Organ mit einem Linsensystem. Durch dieses Linsensystem entstehen Bilder von Gegenständen auf der Netzhaut, die im Gehirn verarbeitet werden. Das Auge verfügt über Möglichkeiten,
- Gegenstände in unterschiedlicher Entfernung scharf zu sehen,
- sich Helligkeitsschwankungen anzupassen,
- Farben wahrzunehmen.
Den größten Teil aller Informationen aus unserer Umwelt nehmen wir über unsere Augen wahr. Sie sind ein überaus wichtiges Sinnesorgan.
Aufbau des menschlichen Auges
Das menschliche Auge ist ein kompliziertes Organ, das aus Muskeln, Fasern, Häuten, Nerven und Blutgefäßen besteht (Bild 1). Die nach außen auch als Schutz wirkende Hornhaut, die Augenflüssigkeit in der vorderen Augenkammer, die Augenlinse und der Glaskörper bilden ein Linsensystem, das insgesamt wie eine Sammellinse wirkt. Vereinfacht stellt man in der Physik dieses Linsensystem häufig durch eine Sammellinse dar. Diese Sammellinse hat eine Brennweite von ca. 20 mm. Das entspricht einem Brechwert von 50 Dioptrien.
Beachte: Die Sammellinse in vereinfachten Darstellungen ist nicht identisch mit der Augenlinse (Kristalllinse), die nur ein Teil des optischen Systems Auge ist.
Die Augenlinse ist an Muskeln, den Ciliarmuskeln, aufgehängt. Durch diese Muskeln kann die Krümmung der Augenlinse verändert werden, damit von unterschiedlich weit entfernten Gegenständen auf der Netzhaut ein scharfes Bild entsteht.
Die Iris mit der Pupille als Öffnung wirkt wie eine Blende. Damit kann die Intensität des einfallenden Lichtes gesteuert werden. In der Netzhaut befinden sich die lichtempfindlichen Zellen - etwa 120 Millionen hell-dunkel-empfindlichen Stäbchen und etwa 6 Millionen farbempfindliche Zäpfchen.
-
Aufbau des menschlichen Auges

Wirkungsweise des menschlichen Auges
Fällt von einem Gegenstand Licht auf das Auge, so wird es durch das optische System, das wie eine Sammellinse wirkt, gebrochen (Bild 2). Da sich die Gegenstände in der Regel weit außerhalb der doppelten Brennweite befinden, entsteht auf der Netzhaut ein verkleinertes, umgekehrtes, seitenvertauschtes und reelles (wirkliches) Bild des Gegenstandes.
Die unterschiedliche Helligkeit des Bildes wird durch die Stäbchen und Zäpfchen der Netzhaut in elektrische Impulse umgesetzt. Diese werden zum Gehirn weitergeleitet und dort zu optischen Eindrücken verarbeitet. Wir nehmen aufrechte, seitenrichtige Bilder wahr.
Besonderheiten der optischen Wahrnehmung
Bei der Wahrnehmung mit den Augen treten zwei Besonderheiten auf.
- Unsere Augen registrieren einfallendes Licht stets so, als ob es von einem Ausgangspunkt aus geradlinig in unsere Augen fällt. Das gilt z.B. für Licht, das auf seinem Weg zu den Augen reflektiert oder gebrochen wurde. Deshalb sehen wir auch Bilder von Gegenständen an Stellen (z.B. hinter Spiegeloberflächen), an denen sie in Wirklichkeit gar nicht existieren.
- Da die optischen Eindrücke im Gehirn verarbeitet werden, spielen beim Sehvorgang auch Erfahrungen und Stimmungen eine Rolle. Die optischen Eindrücke eines Försters und eines Stadtbewohners im Wald sind unterschiedlich. Allgemein gilt:
Verschiedene Personen, die ein und denselben Gegenstand betrachten, können unterschiedliche optische Wahrnehmungen haben.
Sehen ist also mehr als nur die optische Abbildung von Gegenständen auf der Netzhaut.
-
Bildentstehung im Auge
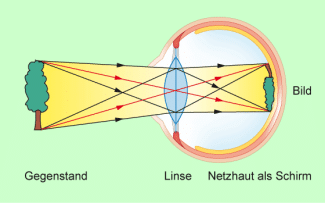
Anpassung des Auges an unterschiedliche Bedingungen
Anpassung an unterschiedliche Entfernungen: Wir wollen mit unseren Augen Gegenstände scharf sehen, auch wenn sich diese in unterschiedlicher Entfernung befinden. Die Anpassung des Auges an die Entfernung - man spricht auch von Akkomodation - geschieht mithilfe der Augenlinse (Bild 3). Durch die Ciliarmuskeln wird die Krümmung der Augenlinse und damit die Brechkraft des Linsensystems stufenlos verändert. Die Augen passen sich unwillkürlich an die jeweiligen Entfernungen an.
Wie stark sich ein normalsichtiges Auge anpassen kann, hängt wesentlich vom Alter der betreffenden Person ab. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Anpassungsfähigkeit an geringe Entfernungen relativ groß. Sie nimmt mit zunehmendem Lebensalter ab. Das ist auch der Grund dafür, dass viele ältere Personen zum scharfen Sehen in geringer Entfernung eine Lesebrille benötigen. Sie gleicht die nicht mehr vorhandene Anpassungsfähigkeit der Augen aus. Eine größere Bildschärfe kann man auch erreichen, wenn die Pupille willkürlich verkleinert wird. Das ist der Grund dafür, dass Personen, die nicht mehr scharf sehen, die Augen zusammenkneifen.
Die kürzeste Entfernung, in der bei einem normalsichtigen Auge ein Gegenstand längere Zeit ohne Überanstrengung betrachtet werden kann, beträgt bei den menschlichen Augen ca. 25 cm. Diese Entfernung von 25 cm wird in der Physik als deutliche Sehweite bezeichnet. Diese deutliche Sehweite wird auch bei der Konstruktion optischer Geräte berücksichtigt.
Verringert man die Entfernung eines Gegenstandes von den Augen immer mehr, so kommt man schließlich zu einem Punkt, bei dem man gerade noch ein scharfes Bild des Gegenstandes sehen kann. Dieser Punkt heißt Nahpunkt. Bei normalsichtigen Kindern liegt dieser Nahpunkt etwa 10 cm vor den Augen. Mit zunehmendem Alter verschiebt sich der Nahpunkt vom Auge weg.
-
Anpassung des Auges an ferne bzw. an nahe Gegenstände durch unterschiedliche Krümmung der Augenlinse
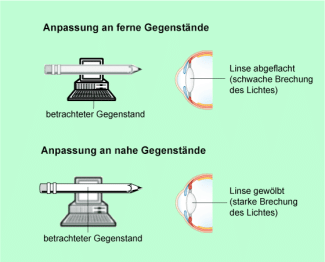
Anpassung an unterschiedliche Helligkeit: Die Gegenstände, die wir betrachten, haben eine sehr unterschiedliche Helligkeit. Damit ist auch die in Richtung Augen fallende Lichtintensität sehr verschieden. Zur Steuerung der in die Augen fallenden Lichtintensität kann die Iris mit der Pupille als Öffnung verändert werden (Bild 4). Bei großer Helligkeit ist die Pupille klein, bei kleiner Helligkeit groß. Damit wird die in die Augen fallende Lichtmenge gesteuert.
Hinzu kommt, dass die hell-dunkel-empfindlichen Stäbchen empfindlicher sind als die farbempfindlichen Zäpfchen, die erst bei ausreichender Lichtintensität ansprechen.
-
Anpassung an unterschiedliche Helligkeit von Gegenständen durch Veränderung der Größe der Pupille
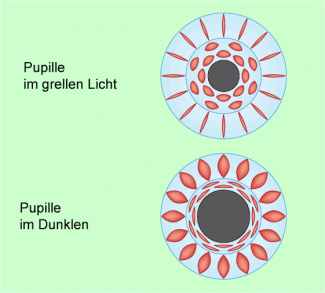
Farbiges Sehen
Für das farbige Sehen sind die ca. 6 Millionen Zapfen in der Netzhaut verantwortlich. Davon gibt es drei Arten: Die eine ist für rotes (langwelliges) Licht am empfindlichsten, die anderen Arten sind es für grünes (mittlere Wellenlänge) und für blaues (kurzwelliges) Licht. Wenn farbiges Licht auf die Zapfen fällt, werden die lichtempfindlichen Zellen gereizt und diese Reize an das Gehirn weitergeleitet. Es ergibt sich ein Farbeindruck, der sich aus den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau zusammensetzt. Dabei wirken die Gesetze der additiven Farbmischung.
Die Zapfen sprechen allerdings nur bei einer ausreichenden Lichtintensität an. Ist sie zu gering, etwa nachts, dann sehen wir nur mit den hell-dunkel-empfindlichen Stäbchen. Der Ausspruch:
"Nachts sind alle Katzen grau."
hat also einen realen physikalischen Hintergrund.
Empfindlichkeit des Auges
Das Auge ist ein sehr empfindliches Sinnesorgan. Es kann eine Vielzahl von Farben bei unterschiedlichen Helligkeiten aufnehmen und verarbeiten. Die Lichtenergie, die gerade noch von den Augen wahrgenommen wird, beträgt etwa .
Das Auflösungsvermögen beträgt etwa 1/60 Grad. Das bedeutet: Zwei Punkte eines Gegenstandes, die man unter einem Winkel von 1/60 Grad sieht, kann man gerade noch als getrennte Punkte wahrnehmen. Das wären 2 Punkte in 1 m Entfernung, die einen Abstand von 0,2 mm voneinander haben.
Augenfehler
Wie auch bei anderen Sinnesorganen können beim Auge angeborene oder erworbene Fehler auftreten. Dazu zählen Kurzsichtigkeit, Übersichtigkeit (Weitsichtigkeit) und Altersichtigkeit sowie Fehler beim Farbensehen (Rot-Grün-Schwäche, Farbblindheit).
Vieler dieser Augenfehler können durch Sehhilfen (Brillen, Kontaktlinsen) oder durch Operationen korrigiert werden. Genauere Informationen zu Augenfehlern und Sehhilfen sind unter diesen Stichwörtern zu finden.
Suche nach passenden Schlagwörtern
- Video
- Farbblindheit
- Kristalllinse
- Übersichtigkeit
- Augenlinse
- Nahpunkt
- Zäpfchen
- Iris
- additive Farbmischung
- Ciliarmuskel
- Augenkammer
- Hornhaut
- Glaskörper
- Pupille
- Altersichtigkeit
- Netzhaut
- deutliche Sehweite
- Rot-Grün-Schwäche
- Stäbchen
- Weitsichtigkeit
- Augenfehler
- Akkomodation
- Ziliarmuskeln
- Sehhilfen
- Brechkraft
- Brechwert
- Kurzsichtigkeit
- Auge
- Brennweite
- Lesebrille

