Binnenmarkt der EU
Der Binnenmarkt ist ein Kernbestandteil der Europäischen Union, da er großen Einfluss auf weitere Politikbereiche der Union hat. So dient er beispielsweise als Grundlage für die Wirtschafts- und Währungsunion. Folglich steht der Binnenmarkt in Zusammenhang mit dem Ziel einer ökonomischen und politischen Integration Europas.
Der Binnenmarkt stellt den Gemeinsamen Markt der Europäischen Gemeinschaft dar. Er ist ein Raum ohne Binnengrenzen und ermöglicht den freien Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehr (vier Freiheiten).
Durch die Herstellung der so genannten „vier Freiheiten“ trägt der Binnenmarkt wesentlich zum Wohlstand in Europa bei, indem er den innergemeinschaftlichen Handel fördert, die Produktivität erhöht und Kosten senkt. Dies wird z. B. durch verstärkten Wettbewerb und Abschaffung der Zollformalitäten erreicht.
Der Binnenmarkt stärkt die Konkurrenzfähigkeit der Europäischen Union auf dem Weltmarkt gegenüber den USA und Japan.
Der Binnenmarkt
Der Binnenmarkt, begrifflich gleichbedeutend mit dem Gemeinsamen Markt, ist eine wichtige Integrationsstufe bei der schrittweisen Annäherung der Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten hin zu einer Wirtschaftsunion, die, im Falle der Europäischen Union, in einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) mündete.
Die Errichtung einer Freihandelszone kann die erste Integrationsform sein, an deren Ende die wirtschaftliche Integration steht. Die Freihandelszone ist ein lockerer Zusammenschluss von Mitgliedstaaten, die ihren Markt für Waren aus den Partnerstaaten öffnen, jedoch ihre Souveränitätsrechte beibehalten.
Eine weitere Integrationsstufe ist die Zollunion: Hier werden zusätzlich zur Öffnung der Märkte für die Waren aus den Mitgliedstaaten gemeinsame Außenzölle festgelegt. Dies bedeutet für die teilnehmenden Staaten den Verzicht auf souveräne Zollgestaltung.
Der Gemeinsame Markt, oder Binnenmarkt, setzt die wirtschaftliche und politische Kooperation der Mitgliedstaaten voraus und ermöglicht den Übergang zur Wirtschaftsunion. Die Mitgliedstaaten übergeben die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Freizügigkeit an Gemeinschaftsinstanzen, die diese koordinieren.
Angelegt war der Binnenmarkt bereits bei den Gründungsvätern der Europäischen Union. Im Gründungsvertrag der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) aus dem Jahre 1951 heißt es, die Gemeinschaft
„beruht auf einem gemeinsamen Markt, verfolgt gemeinsame Ziele und hat gemeinsame Organe.“
In der Präambel hielten die sechs Mitgliedstaaten der EGKS fest,
„durch die Errichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft (...) zu legen.“
Somit wählten die „Väter“ der Europäischen Union den Weg der politischen Integration über die wirtschaftliche Einheit.
Definition des Binnenmarktes
Zum Begriff des Binnenmarktes kann die gesetzliche Regelung des Artikel 14 Absatz 2 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) herangezogen werden:
„Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet ist.“
Ziele des Binnenmarkts
Neben der Herstellung der vier Grundfreiheiten (Bild 1)
- freier Waren-,
- Personen-,
- Dienstleistungs- und
- Kapitalverkehr
soll der Binnenmarkt dazu beitragen, dass sich die EU-Länder wirtschaftlich auf dem Weltmarkt behaupten können. Freilich kann ein Binnenmarkt der Konkurrenz insbesondere durch die beiden anderen weltwirtschaftlichen Industriezentren USA und Japan wesentlich besser begegnen, als ein einzelner nationaler Markt dazu imstande wäre.
Des weiteren bietet der Binnenmarkt den Unionsbürgern vielfältige Vorteile, wie zum Beispiel
- die freie Arbeitsplatzwahl,
- den Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der EU-Staaten
- sowie die Niederlassungsfreiheit.
Das übergeordnete Ziel hingegen war die wirtschaftliche und politische Stärkung der Europäischen Gemeinschaften nach außen, wobei die Schaffung der Europäischen Union auch auf politischer Ebene das endgültige Ziel ist.
Umsetzung des Binnenmarktprojekts
Zur Realisierung des Binnenmarktes ist es unabdingbar, die Wirtschaftspolitiken der einzelnen Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen, sie zu harmonisieren, um die Vorteile, die ein Gemeinsamer Markt ermöglicht, überhaupt erst nutzen zu können. Das bedeutet nichts anderes als die innergemeinschaftlichen Grenzen abzuschaffen und die oben genannten vier Grundfreiheiten herzustellen.
Zur Erreichung dieses Ziels legte die EG-Kommission 1985 unter ihrem damaligen Präsidenten JACQUES DELORS ein Weißbuch über die Vollendung des Binnenmarktes in Europa vor. Dieses enthielt ursprünglich 300 Maßnahmen, die den Binnenmarkt bis 1992 schrittweise aufbauen sollten. Zum rechtlich gültigen Programm wurde der Binnenmarktplan erst durch die Einheitliche Europäische Akte (EEA), die 1987 in Kraft trat.
Die im Weißbuch enthaltenen Vorschläge zielten darauf ab, die bis dato bestehenden
- materiellen,
- technischen und
- steuerlichen
Schranken abzubauen.
Unter materiellen Schranken versteht man
- die Personen- und
- Warenkontrollen
an den Grenzen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (EG).
Mit technischen Schranken werden die unterschiedlichen
- Vorschriften,
- Regelungen,
- technischen Normen und
- Prüfverfahren
bezeichnet, die zwischen den Mitgliedstaaten bestehen und den freien Personen-, Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr behindern. So führten technische Schranken zu einer Isolierung der nationalen Märkte gegenüber Waren aus anderen Ländern. Grund dafür war der von den einzelnen Staaten proklamierte Schutz der inländischen Produktionen mit der durch nationalstaatliche Gesetzgebung entstandenen Qualität der Ware vor möglicherweise minderwertiger Ware aus dem Ausland. Um einen Binnenmarkt zu errichten, war ein EU-weites, einheitliches Regelwerk zur Vereinheitlichung der technischen Vorschriften vonnöten.
Steuerliche Schranken sind unter anderem die indirekten Steuern, die auf Güter und Dienstleistungen erhoben wurden, wobei die Besteuerung in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausfiel. Sie führten zu Wettbewerbsverzerrungen und Grenzkontrollen.
Genauso bewirkten auch die direkten Steuern eine Behinderung des innergemeinschaftlichen Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs.
Zur Beseitigung der materiellen, technischen und steuerlichen Schranken, welche die Gewährleistung der vier Grundfreiheiten zur Folge hatte, können die Organe der EG von drei verschiedenen Methoden Gebrauch machen:
- Eine Methode besteht in der Harmonisierung nationaler Vorschriften, mit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten angeglichen werden. Eine vollkommene Vereinheitlichung des nationalen Rechts ist bei der Methode der Angleichung nicht beabsichtigt; sie hat nur in Ausnahmefällen zu erfolgen. Es gilt demgemäß der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Die Richtlinie ist für den Zweck der Angleichung am besten geeignet. Sie gibt lediglich ein verbindliches Ziel vor – über die konkreten erforderlichen Maßnahmen zu befinden obliegt den einzelnen Mitgliedstaaten. Die zu treffenden Maßnahmen können dadurch besser auf die jeweiligen Gegebenheiten in den einzelnen Staaten abgestimmt werden.
- Eine weitere Methode zur Verwirklichung des Binnenmarkts besteht in der Rechtsvereinheitlichung durch einheitliches EG-Recht. Sie kann sowohl durch Primärrecht als auch durch Sekundärrecht vorgenommen werden.
Wird die Methode der Rechtsvereinheitlichung durch Schaffung Gemeinsamen Rechts angewandt, ist die dafür geeignetste Maßnahme die Verordnung. Sie hat den Vorteil, dass sie nicht der oft langwierigen Umwandlung in nationales Recht bedarf. Allerdings entzieht sie den Mitgliedstaaten den gesetzgeberischen Freiraum, den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Richtlinien besitzen.
Aufgrund des starken Eingriffs einer Verordnung in die Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten macht sie nur dort Sinn, wo die Methode der Rechtsangleichung zum Abbau der Schranken nicht ausreicht. Hier kommt das Subsidiaritätsprinzip zum Tragen, demgemäß eine gesellschaftliche oder staatliche Aufgabe soweit wie möglich von der unteren Einheit wahrgenommen wird, um Maßnahmen effektiv zu gestalten und eine unnötige Regelungsdichte zu vermeiden.
- Neben den Methoden der Rechtsangleichung und der Rechtsvereinheitlichung findet die Methode der gegenseitigen Anerkennung des fremden nationalen Rechts Anwendung. Diese Methode beruht auf dem Grundsatz, dass die jeweiligen nationalen Bestimmungen zum Schutze bestimmter Rechtsgüter in allen Mitgliedstaaten gleichwertig sind. Zu beachten sind gewisse Mindeststandards, auf die sich die Mitgliedstaaten festlegen.
Das Prinzip der Anerkennung hilft, eine Stagnation und Blockade bei der Errichtung des Binnenmarktes abzuwenden, da diese Methode etwaige zähe Verhandlungen im Ministerrat um Einigung auf allzu eng gefasste Formulierungen, wie dies bei Richtlinien und vor allem Verordnungen der Fall sein kann, unterbindet.
Festzuhalten ist, dass das Binnenmarktprogramm durch drei Methoden verwirklicht werden kann: die der Harmonisierung, der Vereinheitlichung durch einheitliches EG-Recht und der gegenseitigen Anerkennung nationaler Vorschriften. Als Mittel dienen
- das primäre EG-Recht,
- Richtlinien und
- Verordnungen.
Hauptsächlich wird nach der Harmonisierungsmethode durch Erlass von Richtlinien verfahren. Nicht zu übersehen ist auch die integrationsfördernde Rolle des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) durch dessen Rechtsprechung bei Grundsatzentscheidungen.
Um den Binnenmarkt zu verwirklichen, müssen die dazu notwendigen Maßnahmen realisiert werden. Das erfordert den Integrationswillen der Mitgliedstaaten, welche die Nutzung der Vorteile des Binnenmarktes um so mehr verzögern, je weniger sie zur Umsetzung der Maßnahmen bereit sind.
-
Die vier Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes
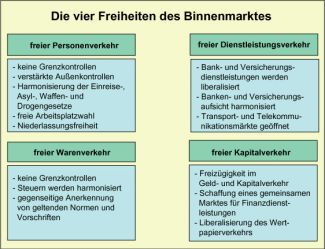
Auswirkungen des Binnenmarktprojekts auf andere
Politikbereiche – Der Binnenmarkt als Bestandteil der Drei-Säulen-Konstruktion
Mit dem „Vertrag über die Europäische Union“ von 1992, im allgemeinen Sprachgebrauch Maastricht-Vertrag oder Unionsvertrag genannt, wurde die Europäische Union (EU) gegründet. Der Unionsvertrag war ein entscheidender Schritt, um dem Ziel einer politischen Union Europas näherzukommen. Um den Aufbau der Union, wie sie im Maastricht-Vertrag festgehalten wurde, bildhaft darzustellen, kann die Tempelkonstruktion herangezogen werden:
Der Tempel würde aus drei Säulen bestehen, auf denen die Europäische Union als gemeinsames Dach ruht.
- Die Europäischen Gemeinschaften (EG), bestehend aus
– EGKS-Vertrag,
– Euratom-Vertrag und
– EWG-Vertrag (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft), bilden die erste Säule. Sie ist zugleich die tragfähigste aller Säulen, da sie vom Grundsatz der Supranationalität als weitestgehende Form der Integration bestimmt ist. Die Reichweite der Entscheidungskompetenzen der EU-Organe ist innerhalb der ersten Säule am größten.
- Die zweite Säule, die „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP), sowie
- die dritte Säule, die „Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit“ (PJZ), sind nicht vergemeinschaftet. In diesen Politikbereichen liegt die Souveränität weiterhin bei den einzelnen Regierungen, jedoch haben sie sich zu intergouvernementaler Zusammenarbeit verpflichtet.
In die erste Säule sind weitere Politikfelder eingebunden, die unmittelbar aus dem Binnenmarktprojekt resultieren, zum Teil aber bereits mit der Gründung der EWG vergemeinschaftet wurden.
Auch die Politikfelder der zweiten und dritten Säule ergeben sich indirekt aus der Verwirklichung des Binnenmarkts. Allerdings weisen die „Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ sowie die „Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit“ deutliche, über die rein wirtschaftliche Integration hinausreichende, Ansätze zu einer politischen Integration auf.
In diesem Zusammenhang kann man von einem so genannten „spill-over-Effekt“ reden, der die Auswirkungen bezeichnet, die das Binnenmarktprojekt auf weitere Politikbereiche ausübt.
Zu diesen Politikbereichen gehören zum Beispiel
- der verstärkte Schutz der Außengrenzen und
- der gemeinsame Kampf gegen Terrorismus, Drogenhandel und organisiertes Verbrechen.
Eine Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in diesen Bereichen ergibt sich aus der Abschaffung der Grenzkontrollen.
Die Vergemeinschaftung weiterer Politikbereiche aufgrund des Binnenmarkts als Zentrum der Europäischen Gemeinschaften soll anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden:
So erfordert das in dem Binnenmarktprojekt enthaltene Ziel des freien Warenverkehrs nicht nur eine einheitliche Zollpolitik der Mitgliedstaaten gegenüber Drittländern, sondern zum Beispiel auch eine gemeinsame Handelspolitik. Dies war unabdingbar, da mit dem Abbau der Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten nationalstaatliche handelspolitische Regelungen in ihrer Durchführung erschwert werden.
Ein weiterer Grund für eine gemeinsame Handelspolitik ist die Gewährleistung des gleichen Außenschutzes der Wirtschaftsteilnehmer gegenüber Drittländern. Auf diese Weise soll das in Artikel 3 EGV Buchstabe g definierte Ziel eines von Wettbewerbsverfälschungen freien Gemeinsamen Marktes erreicht werden. Um Wettbewerbsverzerrungen effektiv zu bekämpfen, initiierten die Teilnehmerstaaten die gemeinsame Wettbewerbspolitik, deren Zuständigkeit in den Bereich der EU-Kommission gemäß Artikel 85 EGV fällt.
Die Anfänge der gemeinsamen Agrarpolitik reichen sogar bis in die Gründung der EWG zurück: Da nach Beschluss der sechs Gründungsmitglieder der EWG auch die landwirtschaftlichen Produkte in den Gemeinsamen Markt einbezogen werden sollten, wurde eine Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) eingeführt. Neben der zu verbessernden landwirtschaftlichen Situation nach dem Zweiten Weltkrieg bestand eine weitere Aufgabe der GAP darin, die Agrarmärkte gemeinsam zu organisieren. Der Tätigkeitsbereich der GAP wandelte sich seit Ende der sechziger Jahre dahingehend, die entstandene Überproduktion der landwirtschaftlichen Erzeugnisse einzudämmen und die Landwirtschaft statt dessen stärker an den Marktbedürfnissen auszurichten.
Ferner legten die EWG-Mitgliedstaaten das Ziel fest, die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen einzelnen Gebieten anzugleichen, woraus die Regionalpolitik als gemeinschaftliches Politikfeld resultierte.
Insgesamt hat sich mit der Ratifizierung des Amsterdamer Vertrages von 1997 die Anzahl der Gemeinschaftspolitiken auf 20 erhöht.
Seine Vollendung fand der Binnenmarkt erst mit der Einführung einer gemeinsamen Währung. Grund dafür sind die Schwankungen der Wechselkurse, die den Handel innerhalb des einheitlichen Wirtschaftsraums hemmen.
Einschränkend ist anzumerken, dass die EU-Staaten bis dato noch nicht alle gemeinschaftlichen Beschlüsse in ihren Ländern umgesetzt haben.
In einigen Bereichen zögern die Regierungen der Mitgliedstaaten gemeinschaftliche Beschlüsse hinaus, wodurch der Binnenmarkt sein volles Potenzial noch nicht entfalten kann.
Der Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen GASP und PJZ, gegebenenfalls sogar deren Aufnahme in den gemeinsamen Besitzstand, unterliegt ebenfalls dem Integrationswillen der Mitgliedstaaten und dem damit verbundenen Souveränitätsverzicht in eben jenen Bereichen.
Suche nach passenden Schlagwörtern
- gegenseitige Anerkennung
- Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)
- Gemeinsamer Markt
- Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
- Maastricht-Vertrag
- Rechtsvereinheitlichung
- vier Grundfreiheiten
- Zollunion
- Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
- Polizeiliche und Justizielle Zusammenarbeit (PJZ)
- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
- Harmonisierung
- Europäische Kommission
- Einheitliche Europäische Akte (EEA)
- EU-Länder
- Freihandelszone

