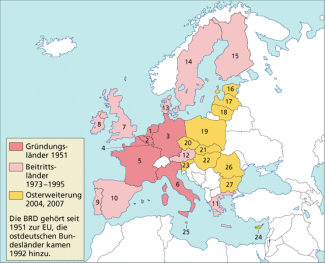Generelles Beitrittsverfahren zur EU
Der europäische Integrationsprozess nahm seinen Anfang in den 1950er-Jahren mit sechs Mitgliedstaaten, zu Beginn des 21. Jh. umfasst die Europäische Union bereits 25. Im Zuge der sogenannten Osterweiterung, der größten Erweiterungsrunde in der Geschichte der Union, traten am 1. Mai 2004 zehn Staaten der EU bei.
Rumänien und Bulgarien folgten am 1. Januar 2007.
Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien.
Das Beitrittsverfahren gliedert sich in drei Phasen. In der ersten Phase stellt der beitrittswillige Staat seinen Antrag an den Rat. Dieser stimmt nach Stellungnahme der Europäischen Kommission und Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ab. Die Verhandlungen werden in Form von Beitrittskonferenzen zwischen dem Kandidatenstaat, der EU-Präsidentschaft und der Kommission geführt. Nach Unterzeichnung der Beitrittsakte beginnt der Ratifikationsprozess. Hierbei müssen sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat zustimmen. Anschließend erfolgt der Ratifikationsprozess in den Mitgliedstaaten sowie dem Bewerberstaat entweder durch Zustimmung der nationalen Parlamente oder Referenden. Sobald alle Ratifikationsurkunden hinterlegt sind, wird der Staat zum ausgehandelten Zeitpunkt in die EU aufgenommen.
Die EU-Erweiterung und ihr historischer Kontext
Seit Beginn des europäischen Integrationsprozesses durch die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahr 1951 durch Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Niederlande und Luxemburg steht die Europäische Union (EU) vor ihrer größten Erweiterungsrunde.
- Die erste Erweiterungsrunde fand 1973 statt und umfasste Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich.
- Mit der Süderweiterung wurde Griechenland 1981 in die Europäische Gemeinschaft (EG) aufgenommen, Spanien und Portugal folgten 1986.
- Die vorerst letzte Erweiterung mit dem EU-Beitritt von Österreich, Finnland und Schweden fand 1995 statt.
- Am 1. Mai 2004 wurde die EU mit einem Schlag um zehn Mitgliedstaaten erweitert: Estland, Lettland, Litauen, die Tschechische Republik, die Slowakische Republik, Polen, Ungarn, Slowenien sowie Malta und Zypern (Bild 1).
2007 folgten Rumänien und Bulgarien. Die so genannte Osterweiterung ist sowohl mit der Herausforderung verbunden, die Handlungsfähigkeit der EU zu bewahren, als auch mit der Chance, dass die EU ihren Einfluss auf internationaler Ebene verstärkt geltend machen kann.
Beitrittsvoraussetzungen: Die Kopenhagener Kriterien
Die Europäische Gemeinschaft (EG) verfolgt seit ihrer Gründung das Konzept der offenen Organisation. Dies bedeutet, dass gemäß Artikel 49 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) jeder europäische Staat die Mitgliedschaft in der EU beantragen kann. Diese ist jedoch seit der Revision des Maastrichter Vertrages durch den Amsterdamer Vertrag 1997 an die Erfüllung bestimmter Grundsätze gekoppelt. Laut Art. 6 Abs. 1 EUV beruht die Union
„auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit (…).“
Außerdem sind die Mitgliedstaaten laut Art. 4 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) gehalten, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben, die
„dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist.“
Allerdings gibt es keinen rechtlichen Anspruch auf die Mitgliedschaft in der EU. Die Aufnahme in die EU ist eine politische Entscheidung, die insbesondere dem Europäischen Rat und den Mitgliedstaaten obliegt.
Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes wurde die Neuorientierung der Staaten Mittel- und Osteuropas (MOE) notwendig. Durch die Aufnahme dieser Staaten sollen die Strukturen der EU auf das östliche Europa ausgeweitet werden, um damit einen Raum der Sicherheit und Stabilität für Gesamteuropa herzustellen.
Der Europäische Rat von Kopenhagen im Juni 1993 hat den MOE-Staaten die Mitgliedschaft in der EU in Aussicht gestellt, sofern sie die so genannten Kopenhagener Kriterien erfüllen:
- politisches Kriterium der institutionellen Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten;
- wirtschaftliches Kriterium einer funktionstüchtigen Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten;
- die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes (so genannter acquis communautaire): die Länder müssen sich die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen machen.
Eine Beitrittsbedingung stellte die EU an sich selbst: Zur Gewährleistung ihrer Erweiterungsfähigkeit sollte sich die EU reformieren.
Beitrittsverfahren
Das Beitrittsverfahren ist ein langwieriger Prozess, der von der Antragstellung bis zum Beitritt eines Landes mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Zu Beginn erfolgt der Beitrittsantrag eines europäischen Staates an den Rat gemäß Art. 49 EUV. Daraufhin gibt die Europäische Kommission eine Stellungnahme in Bezug auf die Vor- und Nachteile eines Beitritts des antragstellenden Staates ab. Im Anschluss daran muss das Europäische Parlament mit der absoluten Mehrheit dem Antrag zustimmen, damit der Rat einstimmig beschließen kann, ob Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Die Verhandlungen werden im Namen der EU-Mitgliedstaaten von der halbjährlich zwischen den Mitgliedstaaten wechselnden EU-Präsidentschaft mit den Bewerberstaaten geführt. Eine entscheidende Rolle im Beitrittsverfahren kommt der Europäischen Kommission zu, da sie die gemeinsame Verhandlungsposition der EU unterbreitet und mit den Beitrittskandidaten Arbeitskontakte unterhält. Seit Herbst 1999 verfügt die Kommission über eine Generaldirektion Erweiterung, die die Arbeiten der Kommission koordiniert und von MICHAEL LEIGH geleitet wird.
Bevor die Verhandlungen aufgenommen werden, findet eine Analyse über den sich unaufhörlich weiterentwickelnden acquis communautaire statt (Screening). Innerhalb dieses Verfahrens legt die Kommission den Bewerberstaaten dar, welche Anforderungen auf sie bei der Übernahme und Anwendung des acquis zukommt. Auf diese Weise erhalten die Bewerberstaaten die Möglichkeit, eine Einschätzung darüber abzugeben, in welchen Bereichen die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes zum Zeitpunkt des Beitritts als problematisch anzusehen ist. Für die Beitrittsverhandlungen wird der gemeinschaftliche Besitzstand (acquis communautaire) in Kapitel eingeteilt. Da der acquis communautaire von dem beitrittswilligen Land in seiner Gänze übernommen werden muss, beziehen sich die Verhandlungen lediglich auf eine Übereinkunft hinsichtlich zeitlich begrenzter Übergangsfristen und Abweichungen. Die einzelnen Kapitel unterscheiden sich in Bezug auf die Dauer der Verhandlungen. Während
- Bildung und Tourismus beispielsweise einfache Verhandlungen erfordern, sind
- die Verhandlungen über den Binnenmarkt,
- die Gemeinsame Agrarpolitik sowie
- die Innen- und Justizpolitik
wesentlich langwieriger. Schließlich erfolgt der Abschluss eines Abkommens gemäß Art. 49 EUV, welches die Aufnahmebedingungen zwischen dem Bewerberstaat und den EU-Mitgliedstaaten festschreibt.
In der Abschlussphase der Verhandlungen, der so genannten Ratifikationsphase, gibt die Europäische Kommission eine Stellungnahme zum Beitritt ab, die den Rat allerdings nicht bindet. Das Europäische Parlament, das ständig über den Verlauf der Verhandlungen informiert wird, muss mit der absoluten Mehrheit der Aufnahme eines Staates zustimmen. Anschließend entscheidet der Rat einstimmig. Haben der Rat und das Europäische Parlament zugestimmt, wird der Beitrittsvertrag von den Staats- und Regierungschefs unterzeichnet. Da der Beitrittsvertrag ein völkerrechtlicher Vertrag ist, muss er sowohl vom beitretenden Staat als auch von allen Mitgliedstaaten gemäß ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Bestimmungen ratifiziert werden. Dieser Prozess nimmt ungefähr zwei Jahre in Anspruch. Das Beitrittsverfahren ist abgeschlossen, sobald die Ratifikationsurkunden hinterlegt wurden. Zum festgelegten Zeitpunkt tritt der Beitrittsvertrag in Kraft und der ehemalige Kandidatenstaat ist Mitglied in der Europäischen Union.
-
Die Mitglieder der Europäischen Union Niederlande (1) Belgien (2) Deutschland (3) Luxemburg (4) Frankreich (5) Italien (6) Dänemark (13) Großbritannien (7) Irland (8) Griechenland (11) Portugal (9) Spanien (10) Österreich (12) Schweden (14) Finnland (15)