Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP)
Auch wenn die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) erst mit der Gründung der Europäischen Union (EU) durch den Vertragsschluss von Maastricht 1992 in dieser Art entstanden ist, gab es schon zuvor Versuche der Integration dieses Politikfeldes. Allerdings scheiterten sowohl die Pläne zur Installierung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 1950-54 als auch die Fouchet-Pläne 1960-62. Als Vorläufer der GASP kann die seit 1970 informell bestehende Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) angesehen werden, die 1987 mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) rechtlich verankert wurde.
Durch die GASP soll das politische Gewicht der Union an ihre ökonomische Stärke anglichen werden, indem der Union die dafür notwendigen Instrumente zur Verfügung gestellt werden (Gemeinsamer Standpunkt, Gemeinsame Aktion und Strategie) und entsprechende Strukturen installiert werden (Hoher Vertreter der GASP) sowie im Rahmen der ESVP die notwendigen militärischen und nicht-militärischen Fähigkeiten aufzubauen, um die Petersberger Aufgaben eigenständig erfüllen zu können.
Die Herausbildung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik
Der europäische Integrationsprozess hatte zwar bis zum Maastrichter Vertrag von 1992 erhebliche Fortschritte und Erfolge verzeichnen können, jedoch waren diese hauptsächlich wirtschaftlicher bzw. wirtschaftspolitischer Natur. Demzufolge entwickelte sich die Europäische Union (EU) seit ihrem Beginn mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahre 1951 zusehends zu einem Akteur mit stetig zunehmenden Einfluss auf die Weltwirtschaft. Auf der anderen Seite waren Integrationsfortschritte in den Politikbereichen der Außen- und Sicherheitspolitik in einem weitaus geringeren Ausmaß zu verzeichnen. Diese relative Schwäche der Union in diesem Bereich ist mit der besonderen Sensibilität derselben Politiken zu erklären, da diese zu den klassischen Kernkompetenzen des souveränen Nationalstaates zählen und sich aus diesem Grund die Mitgliedstaaten mit – wenn auch nur teilweisen – Kompetenzverlagerungen auf die gemeinschaftliche Ebene besonders schwer taten und auch immer noch tun. Nichtsdestotrotz sind auch vor dem Maastrichter Vertragsschluss eine ganze Reihe von Integrationsversuchen im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik unterschiedlicher Reichweite, insbesondere hinsichtlich der angestrebten Integrationstiefe mit
- den Polen
– intergouvernemental und
– supranational einerseits und - dem inhaltlichen Umfang der Integration andererseits, unternommen worden.
Erste Gehversuche auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik: Europäische Verteidigungsgemeinschaft und Fouchet-Pläne
Der erste Versuch zu einer umfassenden, ihrem Charakter nach supranationalen außen- und sicherheitspolitischen Integration basierte auf einem vom damaligen französischen Premierminister RENÉ PLEVEN im Oktober 1950 präsentierten Plan. Auf Grundlage des so genannten Pleven-Plans wurde im Mai 1952 der Vertrag zur Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) von den sechs Mitgliedstaaten der EGKS unterzeichnet. Im Rahmen der EVG sollte eine integrierte europäische Armee unter der Kontrolle eines europäischen Verteidigungsministers geschaffen werden. Entsprechend dem Charakter der EGKS sollte also ein zuvor der nationalstaatlichen Kontrolle der EGKS-Staaten unterliegender politischer Sachbereich vergemeinschaftet werden, d. h. fortan supranational geregelt werden. Das höchst ambitionierte Vorhaben der EVG überforderte die noch junge Gemeinschaft und scheiterte letztlich an der französischen Nationalversammlung im Jahre 1954.
Die Anfang der 1960er-Jahre geführten Verhandlungen über die so genannten Fouchet-Pläne, benannt nach dem französischen Botschafter CHRISTIAN FOUCHET, stellten den zweiten Versuch der Gemeinschaft hinsichtlich einer außen- und sicherheitspolitischen Integration dar. Sie hatten die Gründung einer politischen Union mit
- einer einheitlichen Außenpolitik,
- der Stärkung der Sicherheit der Mitglieder und
- einer gemeinschaftlichen Koordinierung der Verteidigungspolitik
zum Ziel. Letztlich scheiterte dieses Vorhaben im Jahre 1962 aber ebenso wie die vorherigen Pläne zur Gründung der EVG, da keine Einigung zwischen den Verhandlungspartnern aufgrund der Skepsis der Nationalstaaten gegenüber einem zu großen Souveränitätsverlust erreicht werden konnte.
Die Grundsteinlegung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik: Die Europäische Politische Zusammenarbeit
Nachdem die ersten beiden Anläufe zu einer außen- und sicherheitspolitischen Integration der Mitgliedstaaten gescheitert waren, wurde mit der Gründung der auf dem Davignon-Bericht basierenden Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) im Jahre 1970 der politische Durchbruch erzielt und damit gleichsam auch der Grundstein für die später im Vertrag von Maastricht eingeführte Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU gelegt.
Im Rahmen der EPZ sollten zum einen die außenpolitischen Standpunkte zwischen den Mitgliedstaaten ausgetauscht und hinsichtlich der für die Gemeinschaft als Ganzes relevanten Fragen eine möglichst weitgehende Harmonisierung stattfinden. Aufgrund der EPZ kam es zwar in der Folgezeit zu einer Intensivierung der außenpolitischen Zusammenarbeit, jedoch war diese nicht supranational organisiert, sondern beruhte ausschließlich auf dem politischen Konzept der intergouvernementalen Regierungszusammenarbeit. Außerdem handelte es sich bis zum Inkrafttreten der Einheitlichen Europäische Akte (EEA) im Jahre 1987 um eine rein informelle bzw. nicht institutionalisierte, d. h. nicht in die Gemeinschaftsverträge aufgenommene, Zusammenarbeit. Eine Institutionalisierung der EPZ erfolgte also erst mit Inkrafttreten der EEA, in deren Rahmen auch ein EPZ-Sekretariat mit Sitz in Brüssel installiert wurde. Insgesamt erfolgte durch die EEA zwar die rechtliche Verankerung der EPZ, allerdings erfuhr dadurch die EPZ letztlich keine grundlegende Aufwertung, da sich der strukturelle Charakter der lediglich zwischenstaatlichen Zusammenarbeit nicht änderte.
Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik seit dem Maastricht-Vertrag
Mit dem Vertrag von Maastricht im Jahre 1992 wurde aus der EPZ die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die innerhalb der auf drei Säulen (Bild) basierenden Tempelkonstruktion der 1992 geschaffenen Europäischen Union (EU) die zweite Säule ausmacht. Dabei beruht die GASP auf der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, d. h. dass die Beschlussfassung die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten voraussetzt. Die GASP erfuhr in der Folgezeit eine Reihe von Weiterentwicklungen und Ausdifferenzierungen, insbesondere durch die Vertrag von Amsterdam im Jahre 1997 sowie 2000 durch den Vertrag von Nizza, durch den die GASP um die Komponente der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) erweitert wurde.
Ziele, Instrumente und Akteure von GASP
Gemäß Titel V, Artikel 11 des Vertrages über die Europäische Union (EUV) verfolgt die Union auf dem Gebiet der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik folgende Ziele:
„... [D]ie Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Interessen, der Unabhängigkeit und der Unversehrtheit der Union im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen;
die Stärkung der Sicherheit in allen ihren Formen;
die Wahrung des Friedens und die Stärkung der internationalen Sicherheit entsprechend den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen sowie den Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und den Zielen der Charta von Paris, einschließlich derjenigen, welche die Außengrenzen betreffen;
die Förderung der internationalen Zusammenarbeit;
die Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten.“
Ferner verfolgt die EU mit der GASP gemäß Artikel 2 der Gemeinsamen Bestimmungen EUV folgendes Ziel:
„[D]ie Behauptung ihrer Identität auf internationaler Ebene, insbesondere durch eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wozu nach Maßgabe des Artikels 17 auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte.“
Zu den im Maastrichter-Vertrag fixierten außen- und sicherheitspolitischen Kerninstrumenten der Union zählen
- Gemeinsame Standpunkte und
- Gemeinsame Aktionen.
Bei Gemeinsamen Standpunkten müssen die einzelstaatlichen Politiken der Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Gemeinsamen Standpunkt der Union zu einem bestimmten Sachbereich stehen. Ein Beispiel hierfür stellt der Gemeinsame Standpunkt hinsichtlich des illegalen Handels mit Blutdiamanten. Gemeinsame Aktionen sind operative Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Rahmen der GASP. Als Beispiel kann die Unterstützung der palästinensischen Autonomiebehörde bei der Bekämpfung terroristischer Aktivitäten herangezogen werden.
An der GASP sind zahlreiche Akteure beteiligt:
- Der Europäische Rat,
- der Ministerrat,
- das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK),
- die Europäischen Korrespondenten,
- die GASP-Arbeitsgruppe sowie
- die GASP-Berater.
Durch den Amsterdamer Vertrag von 1997 wurde hinsichtlich des Beschlussfassungsverfahrens die Möglichkeit der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit in einigen wenigen Bereichen eingeführt. Des Weiteren wurde die Europäische Kommission stärker in die repräsentativen und exekutiven Aufgaben der GASP eingebunden. Darüber hinaus hat die EU die Möglichkeit, dass die so genannten Petersberger Aufgaben durch die Westeuropäische Union (WEU) ausgeführt werden.
Zu den Petersberger Aufgaben, die 1992 von der WEU in Reaktion auf die gewandelten sicherheitspolitischen Realitäten und damit verbundene Herausforderungen beschlossen worden sind, zählen
- humanitäre Aufgaben und
- Rettungseinsätze,
- friedenserhaltende Aufgaben sowie
- Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung.
Mit dem Amsterdamer Vertrag wurde das Instrumentarium der GASP durch die Einführung der Gemeinsamen Strategie erweitert. Mit dem Mittel der Gemeinsamen Strategie fixiert der Europäische Rat mit Einstimmigkeit die Gemeinsame Strategie in denjenigen Sachbereichen, in denen die Mitgliedstaaten gemeinsame Interessen von zentraler Bedeutung haben. Im Rahmen dieses Instruments erfolgt die Festlegung von Zielen, der Dauer sowie der von den Mitgliedstaaten und der Union zur Verfügung gestellten Mittel. Dadurch können Gemeinsame Aktionen und Standpunkte umgesetzt werden.
Ein weiteres Novum stellt die Schaffung des Amtes eines Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik dar. Dieses Amt nimmt der Generalsekretär, derzeit JAVIER SOLANA, in Personalunion wahr. Sein Aufgabengebiet umfasst die Repräsentation der GASP nach außen sowie die Unterstützung des Rates in Bezug auf gemeinsame außen- und sicherheitspolitische Angelegenheiten. Zusammen mit dem Außenminister des Landes, das die Ratpräsidentschaft innehat und dem Kommissionsmitglied, das für die Außenbeziehungen zuständig ist sowie eventuell einem Vertreter des Landes der darauf folgenden EU-Präsidentschaft bildet der Hohe Vertreter der GASP die so genannte Troika. Diese ist ebenfalls mit der Durchführung der GASP betraut.
In die Verantwortlichkeit des Hohen Vertreters für die GASP fällt die so genannte Strategieplanungs- und Frühwarneinheit. Deren hauptsächliche Aufgaben bestehen in
- der Beschaffung,
- dem Austausch,
- der Analyse und Bewertung von für die GASP relevanten Informationen sowie
- der Ausarbeitung von Handlungsoptionen für den Rat.
Gemäß dem Amsterdamer Vertrag werden operative Ausgaben der GASP durch den Gemeinschaftshaushalt getragen, es sei denn, es handelt sich um Operationen militärischen Charakters bzw. verteidigungspolitischer Natur, oder der Rat entscheidet einstimmig gegen diesen Finanzierungsgrundsatz. In diesem Falle muss sich ein Mitgliedstaat bei seiner konstruktiven Stimmenthaltung auch nicht an der Finanzierung beteiligen.
Bei der Realisierung der GASP setzt die EU auf internationale Zusammenarbeit insbesondere mit
- der NATO,
- der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und
- den Vereinten Nationen (UN).
Der Vertrag von Nizza, der 2003 in Kraft getreten ist, enthält neue GASP-Bestimmungen. Die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit wurde ausgeweitet, außerdem wurde die Rolle des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees bei Krisenbewältigungsoperationen gestärkt.
Die Entwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen der GASP
Im Zusammenhang mit der GASP steht auch die Entwicklung der gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) als integraler Bestandteil derselben. Entscheidende Schritte dazu wurden auf den EU-Gipfeln in Köln und Helsinki 1999 unternommen sowie zwei Jahre später auf dem Gipfel von Göteborg.
Die ESVP hat ein umfassendes sicherheitspolitisches Konzept. Sie soll sowohl
- auf dem Gebiet der Krisenvorsorge,
- der Krisenbewältigung
- als auch auf dem der Krisennachsorge
agieren. Im Vordergrund der ESVP steht die autonome Erfüllung der Petersberger Aufgaben, jedoch im Rahmen eines UN- oder OSZE-Mandats. Während die Union anfangs das Vorhaben verfolgte, die Westeuropäische Union (WEU) als „militärischen Arm“ der EU auszubauen, verfügt sie mittlerweile über eigene Krisenbewältigungsstrukturen, was jedoch nicht die Schaffung einer europäischen Armee bedeutet. Dem sicherheitspolitischen Konzept der ESVP liegt somit ein erweiterter Sicherheitsbegriff zugrunde, dieser umfasst
- neben der militärischen Dimension von Sicherheit
- auch die politische,
- wirtschaftliche und
- humanitäre Dimension.
Diesem Konzept folgend verfügt die ESVP sowohl über militärische (hierbei wird auf bestehende Strukturen zurückgegriffen) als auch über zivile (Polizei-, Justiz-, Katastrophenschutz- und Verwaltungskräfte) und finanzielle Krisenmanagementfähigkeiten. Bis 2010 soll u. a. das „Battlegroup Konzept“ erfüllt werden. Ziel ist es, Ressourcen für 13 Battlegroups zu jeweils 1500 Soldaten zu schaffen und diese inklusive notwendiger See- und Lufteinheiten innerhalb von zehn Tagen nach Einsatzbeschluss weltweit verlegen zu können.
Um ein effektives Krisenmanagement der ESVP zu gewährleisten, sind entsprechend effektive Entscheidungsstrukturen derselben notwendig.
- Neben dem Ministerrat, der oberstes Beschlussfassungsorgan ist,
- sind das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK),
- der Ausschuss für zivile Aspekte des Krisenmanagement und
- als militärische Gremien der Militärausschuss (EUMC) und
- der Militärstab (EUMS)
aufgebaut worden oder befinden sich noch im Aufbau. Zur Sicherstellung des reibungslosen Zusammenspiels der genannten Organe sind Krisenmanagementverfahren (KMV), die ständig weiterentwickelt werden, erarbeitet worden.
Die Entwicklung der ESVP folgt der Prämisse, Doppelungen oder Konkurrenzsituationen mit bestehenden sicherheitspolitischen Institutionen, insbesondere der NATO, zu vermeiden. Dieser Prämisse entsprechend erfolgt der Aufbau der ESVP in enger Kooperation mit der NATO, und außerdem wird der komplementäre Ansatz der ESVP deutlich. Die Kooperation verdeutlicht sich in der Möglichkeit, dass die EU im Rahmen der ESVP auf bestehende Strukturen der NATO zurückgreifen kann und dass die ESVP nur tätig wird, wenn die NATO als Ganzes nicht agiert. Die ESVP könnte somit möglicherweise als regionale Ausdifferenzierung der NATO bezeichnet werden.
-
Die drei Säulen der Europäischen Union
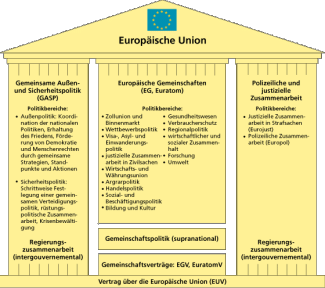
Suche nach passenden Schlagwörtern
- EVG
- Gemeinsame Standpunkte
- WEU
- ESVP
- Petersberger Aufgaben
- Westeuropäische Union
- GASP
- EEA
- Hoher Vertreter der GASP
- Gemeinsame Aktionen
- Europäische Politische Zusammenarbeit
- Javier Solana
- Europäische Verteidigungsgemeinschaft
- Pleven-Plan
- Fouchet-Pläne
- EPZ
- Amsterdamer Vertrag
- Gemeinsame Strategie
- Schnelle Eingreiftruppe
- Vertrag von Maastricht
- Europäische Einheitliche Akte
- Vertrag von Nizza
- Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik
- Battlegroup Konzept
- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

